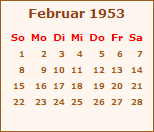Februar 1953 – natürliche und politische
Überschwemmungen
Nicht nur an den Küsten der
Niederlande gab es Überschwemmungen, auch
Berlin (West) wurde überschwemmt – mit Flüchtlingen.
Die Anzahl derer, die die DDR freiwillig verließen,
nahm täglich zu. Die Nachkriegssituation war in den
beiden deutschen Staaten gegensätzlich. Von
bundesdeutscher Seite achtete man darauf, dass keine
Vereinbarungen getroffen wurden, die später eine
Wiedervereinigung unmöglich machten. Und die USA
achteten darauf, dass die Bundesrepublik Deutschland
erstarken konnte, ohne gleich wieder eine
Vormachtstellung in Europa einzunehmen. Ehemaligen
SS-Angehörigen wurde in
Frankreich der Prozess gemacht, auch denen,
die zwangsweise für die deutschen Einheiten arbeiten
mussten. Sie wurden unfreiwillig zu
Kriegsverbrechern wie der Oradour-Prozess zeigte.
Und in der
Sowjetunion ging die Regierungsgewalt immer
noch vom Diktator Stalin aus.
Wichtige Ereignisse
im Februar 1953
1. Februar
Eine verheerende Flutkatastrophe in den Niederlanden führte im Mündungsgebiet
von Rhein, Maas und Schelde ebenso wie an der britischen Ostküste und in Belgien
zu schweren Schäden.
In den Niederlanden kamen insgesamt etwa 1840 Menschen ums
Leben und weitere 300 Menschen starben in Großbritannien. Außerdem gab es
zahlreiche Verletzte. Die Sturmflut war seit 500 Jahren die größte dieser Art.
2. Februar
Der US-amerikanische Präsident
Dwight D. Eisenhower (1890-1969) erklärte in
seiner ersten Rede über die Lage der Nation, die er vor dem Kongress hielt, dass
seine Regierung jene Geheimabkommen mit anderen Staaten aufkündigen werde, die
dazu beigetragen hätten, freie Nationen zu versklaven.
3. Februar
Zum ersten Mal nach einem halben Jahr konnten 38 Deutsche aus sowjetischer
Gefangenschaft in die Bundesrepublik Deutschland bzw. in die
DDR zurückkehren.
3. Februar
In der ägyptischen Hauptstadt Kairo begannen deutsch-ägyptische
Wirtschaftsverhandlungen. Sie scheiterten am 15. Februar ergebnislos.
3. Februar
Die DDR-Einheitspartei SED kritisierte die Verschwendung in den volkseigenen
Betrieben und in der Verwaltung. Sie rief zu einem „allgemeinen Feldzug für die
Durchsetzung des strengsten Sparsamkeitsregimes“ auf.
3. Februar
Der britische Gouverneur in
Kenia (Ostafrika), Sir Evelyn Baring (1903-1973),
verkündete zur Bekämpfung der einheimischen Mau-Mau-Bewegung die Einsetzung
eines Notstandsrates. Im Vorfeld hatten etwa 1500 weiße Siedler ein strikteres
Vorgehen geFordert zum Schutz vor Überfällen. Die Mau-Mau-Bewegung war eine
antikoloniale Unabhängigkeitsbewegung, die sich gegen die weißen Siedler und die
britische Kolonialmacht richtete und diese auch in ihren Grundfesten
erschütterte.
4. Februar
Das Rekrutieren von Deutschen für den Einsatz in fremden Militärdiensten wurde
vom Deutschen Bundestag in § 109h StGB unter Strafe gestellt. Damit sollte dem
Zustrom der Deutschen zur französischen Fremdenlegion Einhalt geboten werden. Es
war wiederholt deshalb zu Konflikten mit den französischen Behörden gekommen.
4. Februar
Der Ministerpräsident der Volksrepublik
China, Zhou Enlai (1898-1976), verlangte
von der US-amerikanischen Regierung, die Waffenstillstandsverhandlungen in Korea
erneut aufzunehmen.
4. Februar
Über den Berliner (West) Radiosender RIAS (Radio im amerikanischen Sektor) hielt
der SPD-Vorsitzende Erich Ollenhauer (1901-1963) eine Ansprache an die
Bevölkerung der DDR, in der er erklärte, dass seine Partei die geplante
Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) ablehne, um die die
Wiedervereinigung Deutschlands nicht zu gefährden.
4. Februar
Der DDR-Schriftsteller und Textdichter der DDR-Nationalhymne, Johannes R. Becher
(1891-1958), erhielt in
Moskau den „Internationalen Stalinpreis für die
Festigung des Friedens zwischen den Völkern“. Der Preis wurde zwei Jahre später
in „Internationaler Leninpreis“ umbenannt. Er war am 20. Dezember 1949
anlässlich des 70. Geburtstages von
Josef Stalin (1878-1953) für eine jährliche
Verleihung gestiftet worden. Die Angaben, wann genau Becher diesen Preis
erhielt, differieren in den Veröffentlichungen. Wahrscheinlich ist das hiesige
Datum.
5. Februar
Der US-amerikanische Außenminister John Foster Dulles (1888-1959), der sich
zwischen dem 29. Januar und dem 8. Februar auf einer Informationsreise durch
Westeuropa befand, traf zu einem zweitägigen Besuch in Bonn ein.
5. Februar
An den Küsten der Niederlande, Belgiens und Großbritanniens kam es den
Überschwemmungsgebieten wiederholt zu Deichbrüchen.
5. Februar
Die Büros vermeintlicher kommunistischer Tarnorganisationen wurden in der BRD in
einer landesweiten Polizeiaktion durchsucht. Unter dem Vorwurf des Hochverrats
wurden mehrere Funktionäre festgenommen.
6. Februar
Die Bundesregierung stockte die Sonderausgaben für den Wohnungsbau zugunsten von
DDR-Flüchtlingen von 90 auf 180 Mio. DM auf. Außerdem erklärten sich die
Ministerpräsidenten der Bundesländer bereit, der steigenden Anzahl von
Flüchtlingen derart zu begegnen, monatlich 30.000 von ihnen in ihrem jeweiligen
Bundesland aufzunehmen. Diese Entscheidung fiel auf einer Konferenz mit der
Bundesregierung.
6. Februar
Die Lohn- und Preiskontrollen, die die USA 1950 nach dem Ausbruch des
Koreakrieges eingeführt hatte, wurden aufgehoben.
6. Februar
Die Verhandlungen der stellvertretenden Außenminister der drei Westmächte
(
Frankreich, USA und Großbritannien) und der Sowjetunion, die den
österreichischen Staatsvertrag zum Inhalt hatten, wurden wieder aufgenommen. Sie
waren vor zwei Jahren unterbrochen worden.
6. Februar
Der Entwurf der Bundesregierung zur Angleichung des Familiengesetzes an den
Grundsatz der Gleichberechtigung von Mann und Frau, stieß bei der katholischen
Kirche auf scharfe Ablehnung. Die Deutsche Bischofskonferenz reagierte mit einer
offiziellen Eingabe. Unter anderem Forderte die Kirche, dass die
Entscheidungsbefugnis des Mannes in bestimmten Fragen unantastbar bleiben
sollte, da sie der „natürlichen Ordnung“ entspreche.
6. Februar
Das von der
Bundesregierung vorgelegte Wahlgesetz mit den Stimmen der
sozialdemokratisch regierten Länder sowie der Koalitionsregierung aus Liberalen
und Sozialdemokraten in
Baden-Württemberg wurde vom Deutschen Bundestag
abgelehnt.
7. Februar
Parteichef und Staatsoberhaupt der
Volksrepublik China,
Mao Zedong (1893-1976),
rief das chinesische Volk dazu auf, den Koreakrieg bis zum endgültigen Sieg
fortzusetzen und außerdem den Kampf gegen die USA in Ostasien zu verstärken.
8. Februar
Auf Weisung der Oberbundesanstalt wurden acht Funktionäre der „Sozialistischen
Aktion“ bei einem Treffen in Worms festgenommen. Die Gruppe wurde als eine
kommunistische Tarnorganisation bezeichnet, die staatsfeindliche Aktionen
vorbereitet habe, hieß es in der Begründung des Haftbefehls.
8. Februar
Die schwere Grippeepidemie, die in
Bayern grassierte, hatte bis dato 226
Todesopfer geFordert. Neuerkrankungen wurden jedoch weniger.
9. Februar
Die Gespräche zwischen den drei Westmächten und der Sowjetunion über den
österreichischen Staatsvertrag am 6. Februar nach zweijähriger Unterbrechung
wieder aufgenommen worden waren, wurden erneut auf unbestimmte Zeit vertagt, da
sie ergebnislos geblieben waren.
9. Februar
In der französischen Hauptstadt begannen Verhandlungen zwischen den Regierungen
Frankreichs und des Saargebietes. Es ging um eine Revision der Saar-Konventionen
von 1950.
9. Februar
In Tel Aviv (Israel) war ein Bombenanschlag auf die Botschaft der Sowjetunion
verübt worden. Im Vorfeld des Attentates war es in Israel zu Protestaktionen
gekommen, die sich gegen die Judenverfolgung in der
UdSSR gewandt hatten.
10.
Februar
In den DDR-Ostseebadeorten und auf der Insel Rügen
begannen staatliche Maßnahmen, die unter dem Namen
„Aktion Rose“ anliefen. Ziel der Aktion war es,
schnell die strikte Umsetzung des
Volkseigentumsschutzgesetzes vom September 1952 im
Sinne der SED und deren Enteignungsvorhaben
umzusetzen. Mittelständlern drohten abschreckende
Zuchthausstrafen bei Gegenwehr. Mit der „Aktion
Rose“ statuierte die DDR an der Ostseeküste ein
Exempel. Hauptsächlich sollten Hotels,
Erholungsheime und Dienstleistungsunternehmen in
staatliche Hand übergehen. Die Ostseeküste sollte
zugleich eine „Schutzzone Ostsee“ in militärischer
Hinsicht werden.
10. Februar
Die Hohe Behörde, das Exekutivorgan der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), das 1952
eingerichtet worden war, eröffnete in sechs Ländern
der Europäischen Gemeinschaft (Niederlande,
Belgien,
Deutschland,
Frankreich, Italien und Luxemburg) den
gemeinsamen Markt für Kohle, Eisenerz und Schrott.
10. Februar
Auf Beschluss des Bundeskabinetts wurde die
paramilitärische neonazistische Gruppe „Freikorps
Deutschland“ verboten. Mehrere Funktionäre dieser
verfassungsfeindlichen Organisation wurden
verhaftet.
10. Februar
Das Bundesvertriebenenministerium in Bonn wurde mit
der Zentralstelle für Sowjetzonen-Flüchtlinge
erweitert. Der CDU-Bundesbeauftragte für
innerdeutsche Umsiedlung, Peter Paul Nahm
(1901-1981), wurde mit der Leitung betraut.
10. Februar
Einer Regierungsverordnung in
Polen zufolge durften
kirchliche Würdenträger von nun an nur noch mit der
Zustimmung zuständiger staatlichen Stellen ernannt
werden.
10. Februar
Die Regierung Ägyptens verkündete eine provisorische
Verfassung. Sie bestimmte, dass Ministerpräsident
Ali Muhammad Nagib (1901-1984) als
„Oberkommandierender der Streitkräfte und Führer der
Revolution“ für drei Jahre oberster Machthaber des
Landes wurde.
11. Februar
Die Sowjetunion brach ihre diplomatischen
Beziehungen zu Israel ab. Der Grund war ein
Sprengstoffanschlag auf die Botschaft der UdSSR in
Tel Aviv, wofür die sowjetische Führung der
israelischen Regierung Mitverantwortlichkeit
vorwarf.
11. Februar
Das Gnadengesuch des US-amerikanischen Ehepaares
Julius (1918-1953) und Ethel Rosenberg (1915-1953),
das wegen angeblicher Atomspionage für die
Sowjetunion zum Tode verurteilt worden war, wurde
von US-Präsident
Dwight D. Eisenhower (1890-1969)
abgelehnt. Der Prozess gegen die Rosenbergs, der am
6. März 1951 begonnen hatte, hat weltweites Aufsehen
erregt und gegen das Todesurteil gab es weltweite
Proteste.
11. Februar
Die Regierung Argentiniens (Südamerika) verfügte die
Rückgabe der deutschen Patente, die während des
Zweiten Weltkrieges in ihrem Land beschlagnahmt
worden waren.
12. Februar
Der neue Hohe Kommissar der USA in Deutschland,
James Bryant Conant (1893-1978), trat sein Amt in
Bonn an. Conant teilte vor der Presse mit, dass die
USA kein Geheimabkommen mit der UdSSR über
Deutschland getroffen hätte.
12. Februar
In einem Schreiben der Hohen Kommission der
westlichen Alliierten äußerte diese Bedenken gegen
die geplante Steuerreform. Die Hohe Kommission sah
dadurch die Finanzierung des bundesdeutschen
Verteidigungsbeitrages als gefährdet an.
12. Februar
In der ägyptischen Hauptstadt Kairo wurde ein
britisch-ägyptisches Abkommen unterzeichnet, in dem
es um die Zukunft des Sudan ging. Die sudanesische
Bevölkerung sollte dieser Vereinbarung entsprechend
1956 in einem Referendum entscheiden dürfen zwischen
der Selbständigkeit des Landes oder einer Union mit
Ägypten.
13. Februar
In der DDR verurteilte das Bezirksgericht Dresden
zwölf Angeklagte zu hohen Zuchthausstrafen. Drei der
Angeklagten wurde zu einer lebenslänglichen
Freiheitsstrafe verurteilt. Allen Angeklagten wurde
angebliche Spionage und Terrorismus zur Last gelegt.
13. Februar
Das britische Unterhaus sprach sich gegen die
Wiedereinführung der Prügelstrafe als Maßnahme bei
Gewaltverbrechen aus.
13. Februar
Im Osten des Irans kam es in der Ortschaft Torrud zu
einem schweren Erdbeben. Dabei waren mehr als 1000
Menschen ums Leben gekommen.
13. Februar
In Bordeaux verurteilte das Militärgericht im
sogenannten Oradour-Prozess, der am 12. Januar 1953
begonnen hatte, 45 ehemalige SS-Mitglieder zum Tode.
Für 43 der Angeklagten erfolgte das Urteil in
Abwesenheit. Allen Angeklagten wurde die Beteiligung
an der Ermordung von 642 Menschen in der
französischen Gemeinde Oradour-sur-Glane angelastet.
Das Massaker hatte am 10. Juni 1944 stattgefunden.
13. Februar
In der dänischen Hauptstadt Kopenhagen begann die
erste Sitzung des Nordischen Rates, einer
Versammlung von 53 Parlamentariern aus Dänemark,
Schweden,
Norwegen und Island. Die Sitzung war von
König Frederik IX. (
1899-1972) eröffnet worden. Sie
dauerte bis zum 21. Februar. +14. Februar
In Mailand (
Italien) wurde das Opernwerk „Concerto
scenico“ des Münchner Komponisten Carl Orff
(1895-1982) uraufgeführt. Orff hatte es zu Texten
antiker Dichter komponiert.
14. Februar
In der vietnamesischen Stadt Saigon (heute:
Ho-Chi-Minh-Stadt) war es zu einem Grobrand
gekommen. Dabei wurden etwa 5000 Häuser zerstört.
Mehr als 50.000 Einwohner wurden obdachlos.
14. Februar
In Crans (Schweiz) wurden die Gruppen für
Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 1954
ausgelost. Die deutsche Nationalmannschaft trifft
auf die Mannschaft aus Norwegen und auf die Elf des
Saarlandes. Das
Saarland wurde erst 1957 zu einem
deutschen Bundesland. Seit 1947 war es noch ein
Satellitenstaat mit u. a. eigener Flagge und eigener
Nationalmannschaft.
14. Februar
In einem Rundfunkkommentar sprach sich der
Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks, Walter von
Cube (1906-1984) dagegen aus, DDR-Flüchtlinge in
unbegrenzter Anzahl aufzunehmen, da nur ein kleiner
Teil zu den politisch Verfolgten zu zählen sein. Der
Kommentar sorgte in der Öffentlichkeit für heftige
Proteste.
15. Februar
In der Bundesrepublik Deutschland wurde die
Subventionierung des sogenannten Konsumbrotes
(Roggenmischbrot) eingestellt. In Berlin (West)
wurde die Subventionierung bis 1958 fortgesetzt.
15. Februar
Die deutsch-ägyptischen Wirtschaftsverhandlungen,
die am 3. Februar in Kairo begonnen hatten, wurden
ergebnislos abgebrochen. Der Hauptgrund des
Scheitern war vor allem die Forderung von
ägyptischer Seite, die Bundesregierung solle das
1952 geschlossene Wiedergutmachungsabkommen mit
Israel kündigen.
15. Februar
Dem schwedischen Physiker Erik Lundblad gelang es
erstmals, einen synthetischen Diamanten
herzustellen.
15. Februar
Die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Davos
(Schweiz), die am 8. Februar begonnen hatten, gingen
zu Ende. Die US-Amerikanerin Tenley Albright (*1935)
gewann die Goldmedaille bei den Damen vor der
Deutschen Meisterin Gundi Busch (*1935). Den Titel
bei den Herren holte der US-Amerikaner Hayes Alan
Jenkins (*1933).
16. Februar
Die Regierung der
Niederlande schlug in einer Note
vor, eine Zollunion als Kern eines politischen
Zusammenschlusses der westeuropäischen Staaten zu
schaffen. Die Note war an die Mitgliedsstaaten der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
gerichtet.
17. Februar
Der US-Präsident
Dwight D. Eisenhower (1890-1969)
dementierte auf der ersten Pressekonferenz seit
seinem Amtsantritt die Berichte, wonach die USA
angeblich eine Blockade der
Volksrepublik China bzw.
ein vollständiges Handelsembargo über das Land
verhängen wollten.
17. Februar
Im
Elsass kam es zahlreichen Arbeitsniederlegungen
und Demonstrationen. Grund war der Protest gegen die
Verurteilung ehemaliger elsässischer SS-Mitglieder,
die im sogenannten Oradour-Prozess von einem
Militärgericht in Bordeaux zum Tode verurteilt
worden waren.
17. Februar
Das Abgeordnetenhaus der Südafrikanischen Union
verabschiedete ein Gesetz über die öffentliche
Sicherheit. Darin wurden der Regierung
Sondervollmachten bei der Bekämpfung der Gegner der
Rassentrennungspolitik eingeräumt. Der Regierung
wurde u. a. die Verhängung des Ausnahmezustandes
erlaubt.
18. Februar
Der US-amerikanische Hohe Kommissar der USA in
Deutschland, James Bryant Conant (1893-1978), hielt
eine Rundfunkansprache, in der er der Berliner
Bevölkerung US-amerikanische Hilfsmaßnahmen
zusicherte angesichts der vielen DDR-Flüchtlinge.
18. Februar
Der Parteivorstand der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands (
SPD) wandte sich in scharfer Form
gegen das Wahlgesetz, das von der Bundesregierung
vorgelegt worden war. Die Sozialdemokraten sahen es
als einen Anschlag auf die Grundlagen der BRD an.
19. Februar
Mehrere Mitglieder der evangelischen Studentengemeinden in der DDR wurden
verhaftet. Die Festnahmen basierten auf einem Gesetz, das DDR-Bürgern jeden
Kontakt mit Angehörigen anderer Staaten verbot. Diese Maßnahmen waren Teil
einer verschärften Kampagne gegen die evangelische Kirche in der DDR.
19. Februar
Der Vorstand der DDR-Gewerkschaft FDGB (Freier Deutscher Gewerkschaftsbund) rief
die Arbeiter in den Privatbetrieben der DDR dazu auf, darauf zu achten, ob die
privaten Unternehmer ihren Verpflichtungen gegenüber dem Staat und den
sogenannten volkseigenen Betrieben tatsächlich nachkommen.
20. Februar
Vertreter der beiden deutschen Staaten vereinbarten für das Jahr 1953 im
Interzonenhandel gegenseitige Warenlieferungen im Wert von 408 Millionen
Verrechnungseinheiten.
20. Februar
Der CDU-Politiker und Bundesinnenminister Robert Lehr (1883-1956) legte den
Entwurf eines Rundfunkgesetzes vor. Darin war die Errichtung eines Bundessenders
vorgesehen, der im gesamten Bundesgebiet für die Produktion und die Ausstrahlung
des Fernsehprogramm zuständig sein sollte.
20. Februar
Die Nationalversammlung Frankreichs verabschiedete eine Amnestie für
französische Kriegsverbrecher, die während des
Zweiten Weltkrieges zum Dienst in
deutschen Einheiten gezwungen worden waren. Diese Amnestie war eine Reaktion des
französischen Parlaments auf die massiven Proteste, die sich gegen die
Verurteilung mehrerer Franzosen im sogenannten Oradour-Prozess richteten, bei
dem am 13. Februar die Urteile verkündet wurden. Gegen diese Urteile war es
besonders im Elsass zu Demonstrationen gekommen.
21. Februar
Der Landesverband der Deutschen Partei (DP) in Nordrhein-Westfalen wurde vom
Bundesvorstand der Partei aufgelöst. Der DP-Vorsitzende, Bundesminister Heinrich
Hellwege (1908-1991), gab in der Begründung an, dass die Maßnahme wegen eines
gegen die Bundesführung gerichteten Komplotts im nordrhein-westfälischen
Landesverband gerechtfertigt seien.
21. Februar
Der Vorstand der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes beschloss, seine
Tätigkeit in der DDR einzustellen. Die antifaschistische Zielsetzung der
Organisation sei durch die politische Entwicklung in der DDR bereits
verwirklicht.
22. Februar
In Frankfurt am Main begann die Frühjahrsmesse. Sie dauerte bis zum 26. Februar.
Insgesamt 3500 Aussteller waren auf der Messe vertreten.
Bundeswirtschaftsminister
Ludwig Erhard (1897-1977) betonte in seiner
Eröffnungsrede die Notwendigkeit einer allgemeinen Konvertierbarkeit der
Währungen zu erreichen.
22. Februar
In
Österreich wurde die Sozialistische Partei (SPÖ) unter der Führung von Adolf
Schärf (1890-1965) bei den Nationalratswahlen zur stärksten Partei gewählt. Sie
erreichte einen Stimmenanteil von 42,1 Prozent. Die Österreichische Volkspartei
erhielt 41,3 Prozent der Stimmen. Beide Parteien bildeten eine gemeinsame
Regierung.
22. Februar
Das Endspiel der Deutschen Eishockeymeisterschaft bestritten der EV Füssen gegen
den SC Rießersee. Die finale Partie stand 5:5 bis kurz vor ihrem Ende. Wenige
Sekunden vor dem Schlusspfiff gelang den Füssenern das Siegestor.
23. Februar
Die Regierung
Jugoslawiens gab einen Zehn-Jahres-Plan für die Entwicklung der
Landwirtschaft bekannt. Der Plan verzichtete auf Zwangskollektivierungen, wie
sie in den anderen sozialistischen Staaten vorgenommen worden waren.
23. Februar
An diesem Tag wurden 3200 Flüchtlinge in
Berlin (West) registriert, die aus der
DDR kamen. Derart viele Flüchtlinge an einem einzigen Tag waren bisher noch nie
verzeichnet worden. Wegen der Überfüllung der Notaufnahmelager in Berlin (West)
wurde die Zahl der Flüchtlinge, die ins Bundesgebiet ausgeflogen wurden, auf 950
pro Tag erhöht.
24. Februar
Laut einer Umfrage unter 17.000 Juristen, die die Zeitschrift „Rechtsanwalt und
Notar“ initiiert hatte, sprachen sich 83 % der bundesdeutschen Rechtsanwälte und
Notare für die Wiedereinführung der Todesstrafe aus.
24. Februar
Auf einer zweitägigen Konferenz in der italienischen Hauptstadt
Rom berieten die
Außenminister der sechs Mitgliedsstaaten der Montanunion über den
Zusammenschluss zu einer Europäischen Politischen Gemeinschaft.
24. Februar
In einem Beschluss des französisch-vietnamesischen Militärkomitees hieß es, dass
der Kampf gegen die Vietminh-Rebellen verstärkt von einheimischen Kräften
geführt werden solle. Deshalb wurde angeregt, in Vietnam 40.000 neue Soldaten zu
rekrutieren und die vietnamesischen Einheiten außerdem mit eigenen
Kommandobefugnissen auszustatten.
25. Februar
Das Bezirksgericht Potsdam verurteilte sieben Mitglieder der oppositionellen
Organisation „Widerstandsgruppe deutscher Patrioten“ in der DDR zu langjährigen
Zuchthausstrafen.
25. Februar
Der Präsident der USA,
Dwight D. Eisenhower (1890-1969), erklärte seine
Bereitschaft, bei einem Gipfeltreffen mit dem Parteichef der KPdSU, Josef W.
Stalin (1878-1953), zusammenzukommen.
25. Februar
Das Musical „Wonderful Town“ von Leonard Bernstein (1918-1990) kam in New York
zur Uraufführung.
26. Februar
US-amerikanische Regierungsvertreter bekamen von Bundesfinanzminister Fritz
Schäffer (1888-1967) die Zusage, dass die Bundesregierung bereit sei, im
Haushaltsjahr 1953/1954 einen Betrag von 12,9 Mrd. DM für Verteidigungszwecke
zur Verfügung zu stellen.
26. Februar
In der DDR begann in Leipzig ein zweitägiger Kongress werktätiger Bauern.
DDR-Ministerpräsident Otto Grotewohl (1894-1964) kündigte auf diesem Kongress
die Bildung weiterer Landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften (LPG) an,
zu denen sich die bäuerlichen Betriebe in der DDR zusammenschließen mussten.
26. Februar
Das Gesetz über das sogenannte Notopfer Berlin, das eine Sondersteuer zur
finanziellen Unterstützung von Berlin (West) darstellte und das ursprünglich am
1. April 1953 seine Gültigkeit verlieren sollte, wurde vom Deutschen Bundestag
bis Ende des Jahres 1954 verlängert.
27. Februar
In einem Schuldabkommen erklärte sich die Bundesrepublik bereit zur Übernahme
der Auslandsschulden des Deutschen Reiches seit dem Ersten Weltkrieg. Das
Abkommen wurde in
London unterzeichnet von der BRD, den drei Westmächten
Frankreich, den USA und Großbritannien sowie von 17 weiteren Staaten.
27. Februar
Die Verabschiedung eines Gleichberechtigungsgesetzes sei aus Zeitgründen in der
laufenden Legislaturperiode nicht mehr zu realisieren. Das wurde vom
Bundestagspräsidenten Hermann Ehlers (1904-1954) mitgeteilt.
27. Februar
Bundeskanzler
Konrad Adenauer (1876-1967) und der italienische Ministerpräsident Alcide de Gasperi (1881-1954) unterzeichneten eine Vereinbarung, die u. a.
beinhaltete, dass deutsche Kulturinstitute in Italien wieder von bundesdeutschen
Wissenschaftlern betreut werden konnten.
28. Februar
In der türkischen Hauptstadt
Ankara unterzeichneten die Außenminister
Jugoslawiens, Griechenlands und der
Türkei einen Freundschaftsvertrag zwischen
ihren Ländern. Darin wurde von den drei Balkanstaaten auch die Zusammenarbeit in
Verteidigungsfragen vereinbart.
28. Februar
Auf Drängen des Parlaments und zahlreicher Demonstrationen entschloss sich der
iranische Schah Mohammed Resa Pahlawi (1918-1980), das Land nicht zu verlassen.
Der Schah hatte angekündigt, dass er das Land vorübergehend zu verlassen gedenke
wegen des sich zuspitzenden Machtkampfes mit Ministerpräsident Mohammad
Mossadegh (1882-1967).
Geburtstage
Februar
1953
Februar 1953 Deutschland in den Nachrichten
Coburger Tageblatt vom 26. Februar 1953 ...
Bereits 1953 tauchte der Name SAGASSER in der Zeitung
auf. Auf dem Bild sehen Sie die Ausgabe des Coburger
Tageblatts vom 26. Februar 1953 . wahrlich ...
>>>
Stichtag: WDR 2 Stichtag: 06. Februar 1953: Bischöfe
zu ...
Die Gleichstellung von Mann und Frau war auch in der
Bundesrepublik eine schwierige Geburt. In den 1950er
Jahren darf eine Ehefrau nicht mal ein Konto ....
>>>
6. Februar 1953 - Bischöfe gegen Entwurf für
Gleichstellungsgesetz ...
Als die Bundesregierung unter Konrad Adenauer (
CDU) 1953
einen Gesetzesentwurf zur Gleichberechtigung von Frauen
und Männern vorlegt, regt sich ..
>>>
<<
Das
geschah
1952
|
Das geschah 1954 >>