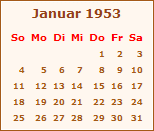Januar 1953 – Kalte Jahreszeit und Kalter
Krieg
Der Kalte Krieg hatte allmählich Gestalt angenommen. Die beiden deutschen
Staaten hatten in ihrer Politik keine Gemeinsamkeiten, woraus sich auch der
enorme Flüchtlingsstrom von Ost nach West entwickelte. Die Gemeinschaft der
westeuropäischen Länder versuchte, zusammenzufinden. Die DDR sah protestierend
zu und war bemüht, ihre Menschen in einem real-sozialistischen Sinne zu
erziehen. Die Aufarbeitung der Verbrechen des Zweiten Weltkrieges in der BRD
zeigte sich in Prozessen und in Verboten rechtsextremistischer Organisationen.
Und die USA hatten ein wachsames Auge auf Europa.
Wichtige Ereignisse
im Januar 1953
1. Januar
Der studierte Jurist und Politiker der Christlichdemokratischen Volkspartei der
Schweiz (CVP), Philipp Etter (1891-1977), trat zum vierten Mal sein Amt als
Bundespräsident der Schweiz an. Etter hatte es jeweils in den Jahren 1939, 1942
und 1947 bereits inne gehabt.
1. Januar
Gemäß einer vertraglichen Einigung erhielt die
Volksrepublik China von der
Sowjetunion die Tschangtschun-Bahn zurück, die die wichtigste Verkehrsverbindung
zwischen der Mandschurei und Sibirien darstellte. Im Abkommen von 14. Februar
1950 war verankert worden, das die Tschangtschuhn-Bahn als gemeinsames Eigentum
und unter gemeinsamer Verwaltung Chinas und der Sowjetunion stehen und die
Strecke zwischen Manchuli und Suifenho sowie die nord-südlich, bzw. südwestlich
verlaufende Anschlussstrecke von Harbin bis Dairen und Port Arthur umfassen
sollte.
1. Januar
Anlässlich des 135. Geburtstages von Karl-Marx (1818-1883) erklärte die
DDR-Regierung das Jahr 1953 zum offiziellen Karl-Marx-Jahr.
1.Januar
Die Malediven, ein Inselstaat im Indischen Ozean, rief die Republik aus.
Mohammed Amin Didi (1910-1954), ein Verwandter des Sultans, übernahm das Amt des
Präsidenten.
1. Januar
In Garmisch-Partenkirchen begann mit dem Auftaktspringen auf der Großen
Olympiaschanze die erste Vier-Schanzen-Tournee. Sie dauerte bis zum 11. Januar
und wurde in zwei österreichischen und zwei deutschen Skiorten veranstaltet.
1. Januar
Die
Country-Legende
Hank Williams stirbt im Alter von 30
Jahren
2. Januar
Das Wolfsburger Volkswagenwerk senkte die Preise für das Standardmodell des
erfolgreichen „Käfers“. Er kostet nun 4200 DM anstatt wie vordem 4400 DM.
2. Januar
Das Politbüro der SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) in der DDR
bereitete eine sogenannte Säuberungswelle innerhalb der Partei vor.
Parteifeindliche Elemente, die in den eigenen Reihen agierten, galt es
aufzuspüren. So hieß es u. a. in einem Beschluss, der zwei Tage später im
Parteiorgan „Neues Deutschland“ veröffentlicht wurde.
3. Januar
Die von der „United States Lines“ betriebene Schiffsverbindung zwischen den
Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik Deutschland wurde feierlich in
Bremerhaven eröffnet. Das bisher schnellste Passagierschiff, die „United States“,
nahm den regelmäßigen Linienverkehr zwischen New York und Bremerhaven auf.
4. Januar
Der Vorschlag des SPD-Politikers Ernst Reuter (1889-1953), der in Ausübung
seines Amtes als Regierender Bürgermeisters von Berlin (West) die Ausrüstung der
West-Berliner Polizei mit automatischen Waffen geFordert hatte, wurde von drei
westlichen Stadtkommandanten der Alliierten abgelehnt.
5. Januar
Im „Théâtre de Babylone“ in Paris fand die Uraufführung des Theaterstücks
„Warten auf Godot“ („En attendant Godot“) des irischen Schriftstellers Samuel
Beckett (1906-1989) statt. Der Erfolg der Aufführung verhalf Beckett zu seinem
internationalen Durchbruch als Autor.
5. Januar
Der britische Premierminister Winston Churchill (1874-1965) war zu einer zu
dreitägigen Gesprächsreise in die USA gereist. Churchill traf u. a. den
amtierenden US-Präsidenten Harry S. Truman (1884-1972) und dessen Nachfolger
Dwight D. Eisenhower (1890-1969), der sein Amt am 20. Januar antreten würde. Bei
seiner Ankunft in New York betonte Churchill, dass der Schwerpunkt des
Ost-West-Konfliktes in Europa liege.
6. Januar
Die Regierung Portugals verabschiedete einen Sechs-Jahres-Plan zur
Wirtschaftsentwicklung des Landes, in dem die Bewässerungsprojekte für die
Landwirtschaft, die Errichtung von Wasserkraftwerken und der Ausbau der See- und
Flughäfen Schwerpunkte bildeten.
6. Januar
In Birma (heute Myanmar) begann die erste Konferenz von 14 asiatischen
sozialistischen Parteien, auf der u. a. die Gründung einer Organisation der
Sozialisten Asiens beschlossen wurde. Der Vorschlag eines Anschlusses an die
Sozialistische Internationale wurde von den Delegierten abgelehnt.
6. Januar
In Köln wurde die Aktiengesellschaft für Luftverkehrsbedarf gegründet. Das
Unternehmen wurde vom Bund, vom Land Nordrhein-Westfalen und von der Bundesbahn
getragen. Die AG bereitete die Errichtung einer deutschen
Luftverkehrsgesellschaft vor.
6. Januar
Der Senat von Berlin (West) gab bekannt, dass nach seinen Schätzungen zum
aktuellen Zeitpunkt etwa 225.000 Flüchtlinge aus der DDR im Westteil der Stadt
lebten, die keine Genehmigung dafür hatten. Angesichts des enormen
Flüchtlingsstromes seien die 70 Notaufnahmelager überfüllt.
7. Januar
In Bonn bekräftigte der SPD-Vorsitzende Erich Ollenhauer (1901-1963) die
Ablehnung seiner Partei zur Europäischen Verteidigungsgemeinschaft und zum
Deutschland-Vertrag. Nach Ansicht der Sozialdemokraten werde dadurch eine
Wiedervereinigung unmöglich gemacht.
7. Januar
Die Entscheidung der britischen Regierung, den arabischen Staaten schwere Waffen
und Kampfflugzeuge zu liefern, führte zum massiven Protest
Israels.
7. Januar
Gegen den Präsidenten von Bolivien (Südamerika), Victor Paz Estenssoro
(1907-2001), wurde ein Putschversuch unternommen, der jedoch scheiterte.
Estenssoro gehörte zu den Gründern der zentralistischen Partei Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR), die im April 1952 eine Revolte anführte, um
die Militärcoups und Diktaturen zu beenden. Der gescheiterte Putsch war vom
rechten Flügel der MNR unterstützt worden.
7. Januar
Die französische Nationalversammlung bestätigte den radikalen Sozialisten René
Mayer (1895-1972) als neuen Ministerpräsidenten. Er siegte mit 389 gegen 205
Stimmen. Das Amt bekleidete Mayer bis zum 28. Juni 1953. Anstelle von Robert
Schumann (1886-1963) übernahm Georges Bidault (
1899-1983) das Außenministerium.
7. Januar
Der US-amerikanische Präsident Harry S. Truman (1884-1972) benannte zum Ende
seiner Amtszeit in seiner letzten Rede an den Kongress über die Lage der Nation
die Entwicklung der Atomenergie der letzten Jahre als die am meisten
einschneidende und gefährlichste Entwicklung. Im Zeitalter der Atomwaffen könne
ein Krieg weder für die USA noch für die Sowjetunion ein Mittel der Politik
sein.
8. Januar
Das Innenministerium von
Hessen verbot den rechtsextremistischen Bund Deutscher
Jugend (BDJ) wegen seiner Verfassungsfeindlichkeit. Das Land Niedersachsen und
die Städte Hamburg und Bremen veranlassten die Auflösung dieser Organisation
ebenfalls wenige Tage später, am 13. Januar.
8. Januar
Die Sozialistische Partei Italiens einigte sich darauf, bei den Parlamentswahlen
im Juni kein Wahlbündnis mit den Kommunisten einzugehen. Das war eines der
Themen, das auf dem Parteitag, der bis zum 11. Januar andauerte, erörtert wurde.
Ein Wahlbündnis mit den Kommunisten war die Partei 1948 letztmalig eingegangen.
8. Januar
Seitens der Parteien Dänemarks gab es eine Übereinstimmung für eine
Verfassungsänderung, die die weibliche Thronfolge ermöglichen sollte. Sie
einigten sich außerdem darauf, die zweite Parlamentskammer, den Landsting,
aufzulösen.
8. Januar
Insgesamt 22 Funktionäre der verbotenen Organisation der kommunistischen Freien
Deutschen Jugend (FDJ) wurden im Kreis Recklinghausen verhaftet.
9. Januar
Während eines Wirbelsturmes geriet ein Passagierschiff vor der südkoreanischen
Hafenstadt Pusan in Seenot. Das Schiff kenterte und riss 249 Menschen in den
Tod.
9. Januar
Im elsässischen Straßburg (
Frankreich) war die sogenannte ad-hoc-Versammlung zur
Schaffung einer Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) zu einer zweitägigen
Beratung zusammengekommen. Gegenstand der Beratung war in einer ersten Lesung
der Entwurf für eine Europäische Verfassung.
10. Januar
In Trier Forderte eine Versammlung von 300 ehemaligen NSDAP-Funktionären, die
dem Verband der ehemaligen Internierten und Entnazifizierungsgeschädigten e. V.
(BIE) angehörten, dass die Entnazifizierungsgesetze von 1945 aufgehoben sollten.
10. Januar
Entsprechend einer Anordnung des US-amerikanischen Präsidenten Harry S. Truman
(1884-1972) sollten alle UNO-Angestellten der USA von einer Beamtenkommission
geprüft werden, um ihre Loyalität gegenüber ihrem Heimatland zu begutachten.
11. Januar
In Emmerich (Nordrhein-Westfalen) konnte der zweite von sieben Kriegsverbrechern
verhaftet werden, die im Dezember des Vorjahres aus dem Gefängnis in Breda
(Niederlande) ausgebrochen waren. Die niederländischen Behörden hatten der
deutschen Polizei Vorwürfe gemacht, dass sie nicht entschlossen genug nach den
flüchtigen Verbrechern fahnden würde.
11. Januar
Im österreichischen Bischofshofen wurde das vierte und letzte Springen der
Vier-Schanzen-Tournee ausgetragen, die am 1. Januar begonnen hatte. Es war das
erste offizielle Deutsch-Österreichische Springen dieser Art. Der Österreich
Sepp Bradl (1918-1982) wurde Sieger in der Gesamtwertung.
12. Januar
Der US-amerikanische Präsident
Dwight D. Eisenhower (1890-199) ernannte den
bisherigen Präsidenten der Harvard-Universität von Cambridge (Massachusetts,
USA), James Bryant Conant (1893-1978), zum neuen Hohen Kommissar der USA in
Deutschland. Nach dem am 21. September 1949 in Kraft getretenen Besatzungsstatus
war Conant damit der höchste Vertreter Amerikas innerhalb der alliierten
Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg.
12. Januar
Die Hohen Kommissare der drei westlichen Besatzungsmächte (
Frankreich, USA,
Großbritannien) vereinbarten, dass die für die bundesdeutsche Industrie noch
bestehenden Produktionsbeschränkungen nur noch solange aufrecht zu erhalten
seien, bis der Deutschlandvertrag und die Europäische Verteidigungsgemeinschaft
von den französischen und bundesdeutschen Parlamenten verabschiedet worden
waren.
12. Januar
In Bordeaux (
Frankreich) begann der Prozess gegen zehn deutsche und elf
französische ehemalige SS-Mitglieder. Ihnen wurde vorgeworfen, am Massaker von
Oradour-sur-Glane beteiligt gewesen zu sein, das am 10. Juni 1944 in der
französischen Gemeinde verübt wurde. Frauen, Greise und Kinder gehörten zu den
642 Menschen, die umgebracht wurden, als bei einem Einsatz der deutschen
Waffen-SS gegen Partisanen der Ort fast vollständig ausgelöscht worden war. Ein
einziges Haus überstand das Massaker und kaum einer der Einwohner überlebte.
12. Januar
Die Meldebestimmungen in Berlin (Ost) wurden von der dortigen Stadtverwaltung
verschärft. Alle Personen, die ständig in einem Haus lebten und Besucher, die
sich länger als drei Tage im Haus aufhielten, mussten in einem eigens dafür
vorgesehenen Hausbuch eingetragen werden, das von den Behörden kontrolliert
wurde.
12. Januar
Das Geheime Konsistorium der Kardinäle in Rom bestätigte die Ernennung von 24
neuen Kardinälen durch Papst Pius XII. (1876-1958). Bereits 1946 hatte das
Kirchenoberhaupt der Katholischen Kirche neue Kardinäle ernannt. Sein Bestreben
ging dahin, das Heilige Kollegium zu erweitern und zu internationalisieren. Es
umfasste mit der neuen Ernennung Vertreter aller Kontinente.
13. Januar
Vom Bayerischen Staatsministerium wurde die rechtsextremistische Organisation
„Deutscher Heimatschutz“ (DHS) verboten.
13. Januar
In einem Fernsehinterview sprach sich der US-amerikanische General und
NATO-Oberbefehlshaber Matthew B. Ridgway (1895-1993) für eine umgehende
Aufstellung deutscher Streitkräfte aus.
13. Januar
In der jugoslawischen Hauptstadt Belgrad wurde von der Nationalversammlung eine
neue Verfassung verabschiedet. In ihr wurde u. a. die Selbstverwaltung der
Betriebe verankert.
14. Januar
Für das neu geschaffene Amt des Staatspräsidenten
Jugoslawiens wurde Marschall
Josip Broz Tito (1892-1918) gewählt. Tito hatte bis dato das Amt des
Ministerpräsidenten inne gehabt. Er gewann die Wahl mit überwältigender Mehrheit
(568 Stimmen gegen eine Stimme).
14. Januar
In der BRD wurde mit sofortiger Wirkung der Schülerlotsendienst eingeführt.
14. Januar
Die Regierung Frankreichs strebe neue Verhandlungen über die Europäische
Verteidigungsgemeinschaft an und wolle Zusatzprotokolle durchsetzen. Das gab der
französische Ministerpräsident René Mayer (1895-1972) bekannt.
14. Januar
Der US-Senat beschloss, sämtliche Bewerber für Ämter im Auswärtigen Dienst ab
sofort von der Bundespolizei FBI auf ihre politische Zuverlässigkeit zu
überprüfen.
15. Januar
Der Außenminister und stellvertretende Vorsitzende der DCU der DDR, Georg
Dertinger (1902-1968) wurde verhaftet. Dertinger wurde Spionage vorgeworfen. Es
kam zu einem Schauprozess des Obersten Gerichts der DDR, bei dem Dertinger zu 15
Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. Er wurde 1954 begnadigt.
15. Januar
In München fand die deutsche Erstaufführung des amerikanischen Filmklassikers
„Vom Winde verweht statt“. Der aus dem Jahr 1939 stammende Film war damals u. a.
mit zehn Oscars ausgezeichnet worden.
15. Januar
Prinz Norodom Sihanouk (1922-2012), der König von Kambodscha (Südostasien),
verhängte den Ausnahmezustand über sein Land. Nachdem sich zwei Tage vorher das
Parlament in der Hauptstadt Phnom Penh geweigert hatte, die Kredite zu
bewilligen, die der König für den Kampf gegen die Kommunisten geFordert hatte,
hatte Sihanouk das Parlament daraufhin aufgelöst. Gleichzeitig verkündete er
seitens seines Landes die politische Unabhängigkeit von Frankreich.
15. Januar
In Düsseldorf, Solingen und Hamburg wurden sieben ehemalige, führende
Nationalsozialisten von den britischen Besatzungsbehörden festgenommen. Ihnen
wurde eine geplante Verschwörung vorgeworfen. Zu den Verhafteten gehörten u. a.
Werner Naumann (1909-1982), einstiger Staatssekretär im Propagandamuseum und der
ehemalige Reichsstudentenführer Gustav Adolf Scheel (1907-1979). Der sogenannte
Naumann-Kreis, dem NS-Funktionäre angehörten, hatte versucht, den
nordrhein-westfälischen Landesverband der Freien Demokratischen Partei (FDP) zu
unterwandern und einflussreiche Positionen zu besetzen.
16. Januar
Der Ministerpräsident Ägyptens, Ali Muhammad Nagib (1901-1984), verfügte die
Auflösung aller politischen Parteien in seinem Land. Außerdem kam es zu
Verhaftungen von 25 ranghohen Offizieren, denen vorgeworfen wurde, ein Komplott
gegen die Regierung vorbereitet zu haben.
16. Januar
Den Vorschlag des SPD-Vorsitzenden Erich Ollenhauer (1901-1963), der in einem
Brief vom 7. Januar 1953 dem Regierungsoberhaupt Konrad Adenauer (1876-1967)
vorschlug, internationale Verhandlungen über ein System kollektiver Sicherheit
in Erwägung zu ziehen, lehnte der Kanzler ab. Er begründete die Ablehnung damit,
dass dies keine realisierbare Alternative zur Europäischen
Verteidigungsgemeinschaft darstelle.
16. Januar
In Bonn verständigten sich die IG Bergbau und der Unternehmensverband
Ruhrbergbau auf verkürzte Schichtzeiten für die Bergleute, die unter Tage
arbeiteten. Ab 1. April 1953 betrug dadurch die tägliche Arbeitszeit 7,5 Stunden
anstatt wie bisher 8 Stunden. Die Regelung wurde bei vollem Lohnausgleich und
einer Sechs-Tage-Woche festgesetzt.
17. Januar
Die Flüchtlingskommission, die der Senat von Berlin (West) gebildet hatte,
beschloss den Ausbau der Notaufnahmelager in der Stadt aufgrund der hohen und
weiter anwachsenden Zahl der DDR-Flüchtlinge.
17. Januar
Im Königreich Irak fanden die ersten freien Parlamentswahlen statt. Die
Unionspartei des Ministerpräsidenten Nuri as Said (1888-1958) ging als stärkste
Partei aus den Wahlen hervor. Das Parlament war größtenteils mit Nuris
Gewährsleuten besetzt, die ihn mit parlamentarischen Vollmachten ausstatteten,
die ihn im Prinzip zum Alleinherrscher des Landes machten.
18. Januar
Vom Hohen Kommissariat der USA in Deutschland wurden Ergebnisse veröffentlicht,
die bei einer Meinungsumfrage zutage gekommen waren. Es hatten 44% der Befragten
angegeben, dass die Ideen des Nationalsozialismus mehr Vorteile als Nachteile
gehabt hätten. Diese Umfrage löste eine heftige Diskussion aus und zeigte die
Gefahren eines Wiederaufflammens des Nationalsozialismus deutlich.
18. Januar
Der Große Preis von Argentinien, der das Auftakt-Rennen der Formel-1-Saison 1953
war, wurde in Buenos Aires ausgetragen. Das Rennen wurde von einem schweren
Unfall überschattet, der sich in der 32. Runde ereignete und als einer der
folgenschwersten in der Motorsport-Geschichte gilt. Der italienische Rennfahrer
und Weltmeister von 1950, Giuseppe Farina (1906-1966) verlor die Kontrolle über
seinen Ferrari. Er hatte einem Zuschauer ausweichen wollen, der über die Straße
gelaufen war. Farina fuhr in eine Zuschauermenge. Mindestens zehn Menschen kamen
ums Leben. Es gab zahlreiche Verletzte. Farina selbst hatte kaum Schaden
genommen. Das Rennen wurde nicht abgebrochen. Farinas Landsmann, Alberto Ascari
(1918-1955), gewann den Großen Preis von Argentinien.
18. Januar
Die Britin Ann Davison (1912-1992) erreichte die Karibik-Insel Dominica auf den
Kleinen Antillen. Sie hatte damit weltweit als erste Frau den Atlantik als
Einhandseglerin überquert.
18. Januar
Bereits 618 Menschen waren in Stuttgart und Umgebung an Typhus erkrankt. Die
Epidemie hatte bereits sieben Todesopfer geFordert.
18. Januar
In Berlin (Ost) ging ein zweitägiger Theaterkongress Ende, der das Thema „Das
sowjetische Theater – unser Vorbild im Kampf um den sozialistischen Realismus an
deutschen Bühnen“ zum Inhalt hatte.
19. Januar
Der Staatspräsident der DDR, Wilhelm Pieck (1876-1960), drohte der
Bundesregierung. Falls die Europäische Verteidigungsgemeinschaft verwirklicht
werden sollte, würde die DDR Maßnahmen gegen Berlin (West) ergreifen.
19. Januar
Die Sondervollmachten von Ministerpräsident und Staatschef des Iran, Mohammad
Mossadegh (1882-1967), die ursprünglich am 9. Februar auslaufen sollten, wurden
vom iranischen Parlament um ein Jahr verlängert, womit Mossadegh
außerordentliche innenpolitische Machtbefugnisse behielt.
20. Januar
In Washington (USA) fand die Amtseinführung des Kandidaten der Republikanischen
Partei,
Dwight D. Eisenhower (1890-1969), als 34. Präsident der Vereinigten
Staaten von Amerika statt. Er war der Nachfolger von Harry S. Truman (1884-1972)
von der Demokratischen Partei.
21. Januar
Vor dem Bundestag wandte sich Kanzler Konrad Adenauer (1876-1967) entschieden
gegen den Eindruck, dass in der Bundesrepublik Deutschland die Zahl der Anhänger
des Nationalsozialismus zunähme, der durch eine Umfrage des Hohen Kommissariats
der USA in Deutschland entstanden war.
21. Januar
Der Entwurf eines neuen Wahlgesetzes, den die Bundesregierung veröffentlichte,
sah eine Erhöhung der Zahl der Abgeordneten im Bundestag vor. Sie sollte von 400
auf 484 aufgestockt werden. Außerdem sah der Entwurf eine Koppelung von
Mehrheits- und Verhältniswahlrecht vor.
21. Januar
Um die Arbeit der sogenannten „Dienststelle Blank“ zu kontrollieren, setzte der
Deutsche Bundestag einen Ausschuss für Fragen der europäischen Sicherheit ein.
Die Blank-Behörde bereitete die Aufstellung bundesdeutscher Streitkräfte vor.
Sie wurde geleitet vom CDU-Sicherheitsbeauftragten Theodor Blank (1905-1972).
Die Behörde war die Vorgängerinstitution des späteren
Bundesverteidigungsministeriums.
21. Januar
Die erste Fernsehsendung der „Augsburger Puppenkiste“ ging über den Bildschirm.
Die Geschichte „Peter und der Wolf“, die im NWDR (Nordwestdeutscher Rundfunk)
aufgenommen wurde, kam in Schwarz-Weiß zur Ausstrahlung.
22. Januar
Der SPD-Politiker und Partei- und Fraktionsvorsitzende, Erich Ollenhauer
(1901-1963), weigerte sich, die Gespräche zwischen den Sozialdemokraten und den
Regierungsparteien über die Deutschland- und Sicherheitspolitik fortzusetzen, da
seiner Ansicht nach, die Bundesregierung keine Verständigungsbereitschaft zeige.
22. Januar
In der DDR wurden Landwirtschafts-Normen zur Pflichtablieferung für
Schlachtvieh, Milch und Eier erhöht.
22. Januar
Im New Yorker „Martin Beck Theatre“ kam das Schauspiel „Hexenjagd“ des
US-amerikanischen Schriftstellers und Dramatikers Arthur Miller (1915-2005) zur
Uraufführung.
23. Januar
In
Ägypten verkündete der Ministerpräsident Ali Muhammad Nagib (1901-1984) die
Gründung einer Nationalen Befreiungsfront. Außerdem rief Nagib während einer
Feier, die an die von Entmachtung von König Faruk I. (1920-1965) am 23. Juli
1952 erinnerte, dazu auf, die britischen Truppen, die in der Suezkanalzone
stationiert waren, aus dem Land zu vertreiben.
23. Januar
Um in Chile (Südamerika) die Inflation zu bekämpfen und die
Verwaltungsstrukturen zu reformieren, wurden dem Staatspräsidenten Carlos Ibáñez
del Campo (1877-1960) vom chilenischen Parlament Sondervollmachten für die Dauer
von sechs Monaten zugebilligt.
24. Januar
Vom Bundesfinanzministerium wurden zusätzliche 90 Millionen DM bereitgestellt,
die dem Bau von Wohnungen für Flüchtlinge aus der DDR dienten.
24. Januar
Das Gesetz zur Sicherung des Straßenverkehrs trat in der Bundesrepublik
Deutschland in Kraft. Unter anderem enthielt es verschärfte Bestimmungen gegen
Alkohol am Steuer. +24. Januar
Das Bayerische Staatsministerium des Innern verbot die Organisation
„Diskussionskreis der ehemaligen SS“.
25. Januar
Auf einer Versammlung in der Frankfurter Paulskirche sprach sich die Deutsche
Wählergemeinschaft gegen Wahlgesetzentwurf aus, der von der Bundesregierung
vorgelegt worden war. Anstelle dieses Entwurfs Forderte die Wählergemeinschaft,
ein reines Mehrheitswahlrecht einzuführen.
25. Januar
Die Deutsche Meisterin im Eiskunstlauf, Gundi Busch (*1935), belegte bei den
Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Dortmund den zweiten Platz. Den
Europameistertitel holte die Britin Valda Oborn (*1934). Die Goldmedaille bei
den Herren gewann der Italienische Meister Carlo Fassi (1929-1997).
26. Januar
Im Hafen von Wantori (Südkorea) sank eine südkoreanische Fähre. Bei dem Unglück
kamen 53 Menschen ums Leben.
26. Januar
Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED), die Kommunistische Partei
Deutschlands (KPD) und die Kommunistische Partei Frankreichs (KPF) wandten sich
in einem gemeinsamen Appell gegen den Deutschland-Vertrag und gegen die
Europäische Verteidigungsgemeinschaft.
26. Januar
In der
französischen Hauptstadt Paris starb der 16-jährige Maurice Rénard, dem
im Dezember 1952 eine Niere implantiert worden war. Rénard hatte die Einsetzung
einer Fremdniere bisher am längsten überlebt.
27. Januar
Der US-amerikanische Politiker und neuer Außenminister, John Foster Dulles
(1888-1959), ließ in einer TV-Rede verlauten, dass die USA ihre außenpolitischen
Schwerpunkte verlagern würde, wenn das Vorhaben eines politischen und
militärischen Zusammenschlusses der westeuropäischen Ländern nicht zustande
kommen sollte.
27. Januar
US-Präsident Dwight D. Eisenhower (1890-1969) gab die Gründung eines Amtes für
die psychologische Planung im Kalten Krieg bekannt. Dem Amt gehörten acht
renommierte Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Presse und Industrie an. Sie
hatten die Aufgabe, alle Regierungsstellen in den USA zu beraten.
28. Januar
Die seit Jahresbeginn in Europa grassierende Grippewelle hatte in der
Bundesrepublik Deutschland derzeit bisher 67 Menschenleben geFordert. Das
Bundesland Bayern war am stärksten betroffen. Hier starben 42 Menschen.
28. Januar
Mit einer Flugdauer von 22 Stunden und einer Minute konnte ein britisches
Düsenflugzeug vom Typ „Canberra“ auf der Strecke London-Australien einen
Geschwindigkeitsrekord aufstellen.
29. Januar
In Paris begann die Konferenz der Verkehrsminister, die bis zum 31. Januar
dauerte. Es nahmen Vertreter von acht westeuropäischen Staaten teil.
29. Januar
In der DDR beschloss der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund (FDGB), die
„kulturelle Massenarbeit“ zu verstärken. Sie sei „das wichtigste Instrument der
Gewerkschaften bei der sozialistischen Erziehung der Werktätigen“.
29. Januar
Die bereits am 1. Januar begonnene Konferenz über die politische Zukunft der
afrikanischen Gebiete zwischen Südrhodesien, Nordrhodesien und Nyassaland ging
in London mit einer Vereinbarung über die Gründung einer Zentralafrikanischen
Union zu Ende. Die Vertreter der schwarzen Bevölkerung, die nicht an den
Gesprächen beteiligt gewesen waren, lehnten das Vorhaben ab.
30. Januar
Eine Änderung der Gesetze über die Sonntagsruhe wurde vom britischen Unterhaus
abgelehnt. Nach bestehender Gesetzeslage waren u. a. Theater- und
Sportveranstaltungen an Sonntagen verboten.
30. Januar
Die von Diktator Francisco Franco (1892-1975) regierte Monarchie Spanien wurde
Mitglied der UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization).
30. Januar
Der ehemalige deutsche Kommandant auf Kreta, Generalmajor a. D. Hans-Georg
Benthack (1894-1973), wurde vom Hamburger Schwurgericht von der Anklage des
Totschlags freigesprochen. Benthack hatte nach der deutschen Kapitulation vier
Soldaten am 10. Mai 1945 wegen Befehlsverweigerung erschießen lassen.
31. Januar
Die Konferenz der Verkehrsminister acht westeuropäischer Länder, die am 29.
Januar in Paris begonnen hatte, endete. Der Ausbau des Netzes europäischer
Durchgangsstraßen sollte vorangetrieben werden.
31. Januar
In Garmisch-Partenkirchen verunglückte bei einem Trainingslauf zu den
Bob-Weltmeisterschaften der Schweizer Weltmeister im Zweierbob, Felix Endrich
(1921-1953), tödlich. Mit einer Geschwindigkeit von 97 km/h war der Schweizer
Viererbob aus der sogenannten Bayernkurve geflogen und 25 Meter weiter mit einem
630 Kilo Gewicht aufgeschlagen. Endrich starb an den Folgen eines Schädelbruchs.
Geburtstage Januar
1953
Januar 1953 Deutschland in den Nachrichten
Augsburger Puppenkiste
WAZ.de
Januar 1953 traten die Marionetten der Augsburger
Puppenkiste erstmals im deutschen Fernsehen auf.
Gespielt wurde Sergei Prokofjews Peter und der Wolf.....
>>>
Neues Deutschland vom 15.01.1953
ND-Archiv
Zum Jahrestag der Ermordung Karl Liebknechts und Rosa
Luxemburgs. An der Schwelle des Karl-Marx- Jahres 1953
gedenkt die deutsche Arbeiterklasse in .....
>>>
Januar 1953 – Seenotkreuzer "Bremen" in Dienst
gestellt
WDR.de
Der Seenotkreuzer "Bremen" der Deutschen Gesellschaft
zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) gilt als Wunderwerk
der Technik. Nach dem Kentern richtet er ..
>>>
Werbung