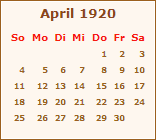April 1920 - Gründung der KAPD
Die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands (KAPD)
wurde am 3. April 1920 in Berlin gegründet. Sie setzte sich
vorwiegend aus Mitgliedern der ehemaligen
Linksopposition der KPD zusammen. Sie lehnte eine
Mitarbeit im Parlament und in den bestehenden
Gewerkschaften ab. Am 1.. April fand in Berlin fand
die erste Versammlung der neu gegründeten
Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands statt. Dabei bezichtige die
Partei die Gewerkschaften des Verrats an den Zielen
des Proletariats und sprachen sich für die
Aufstellung einer Roten Armee im Deutschen Reich
aus.
Wichtige Ereignisse im
April 1920
1. April
Auf Beschluss der Reichsregierung marschieren
Reichswehreinheiten in das Ruhrgebiet ein. Die
Mitglieder des Kabinetts beraten über die möglichen
Folgen dieses Vorgehens für die entmilitarisierte
Zone, da Frankreich den Einmarsch nicht erlaubt
hatte.
1. April
In Essen fand eine Konferenz mit Delegierten der
Arbeiterräte statt. Der KPD-Politiker Wilhelm Pieck
empfahl den Abbruch der Kämpfe im Ruhrgebiet, um
blutige Auseinandersetzungen zu vermeiden. Die
Delegierten wollten die Rote Ruhr auflösen und
stattdessen eine Volksarmee bilden.
1. April
Das Reichskolonialministerium wurde aufgelöst.
1. April
Adolf Hitler verließ den Militärdienst und widmete
sich ausschließlich der Arbeit in der
Nationalsozialistischen Arbeiterpartei (
NSDAP).
1. April
Ein neues Einkommensteuergesetz als Teil einer
Finanzreform des früheren Reichsfinanzministers
Matthis Erzberger trat in Kraft.
1. April
In den deutschen Ländern wurden die sieben
Staatseisenbahnen aufgelöst und in ein einheitliches
Reichsbahnsystem umgewandelt. Gleichzeitig wurden
die Post- und Fernmeldeverwaltungen von der
Reichsverwaltung übernommen.
1. April
Der Eisenwirtschaftsbund nahm seine Arbeit auf. Es
handelte sich dabei um ein Organ für die
Selbstverwaltung von Erzeugern, Händlern und
Verbrauchern der Eisenindustrie. Arbeitgeber und
Arbeitnehmer sind gleichermaßen vertreten.
2. April
Truppen der Roten Armee zwangen den Zentralrat in
Essen zur Flucht.
2. April
Im Ruhrgebiet begann der Einmarsch der Reichswehr.
Laut Reichsregierung hatte sie die Vollmacht, alles
zu tun, was die Lager erForderte, um die Rote
Ruhrarmee aufzulösen.
2. April
Der Verband der Fachpresse Deutschlands richtete
„einen Notschrei“ an die Regierung aufgrund der
Postgebühren und der Erhöhungen des Papierpreises.
2. April
Im Tauentzienpalast in Berlin wurde der Film „Können
Gedanken töten?“ von Adolf Paul in der Regie von
Carl Böse mit Otto Gebühr als Friedrich II. und
Harry Liedtke, Rosa Valetti und Reinhold Schünzel in
weiteren Rollen uraufgeführt.
3. April
In Bottrop fand ein Gefecht zwischen
Freikorpstruppen und Ruhrarmee statt. Von allen
Teilen des Deutschen Reiches aus besetzten
Regierungstruppen Teile des Ruhrgebietes.
3. April
Der Kommunistenführer Max Hölz besetzte das Rathaus
von Plauen und durchzog in den folgenden Tagen
Sachsen mit einer bewaffneten Gruppe.
3. April
Experten besprachen das Projekt einer Stadtbahn
Essen-Bochum-Dortmund, wobei der Bau einer
Untergrundbahn wegen des Bergbaus nicht möglich
erscheint.
3. April
Am Deutschen Theater in Berlin wurde das Stück „Dame
Kobold“ von Calderón in der Bearbeitung von Hugo von
Hofmannsthal von Max Reinhardt inszeniert.
4. April
In Jerusalem kam es zu Auseinandersetzungen zwischen
Juden und Arabern. Von den britischen Behörden wurde
der Belagerungszustand verhängt.
4. April
In Weimar lief das Mysterienspiel „Vom Tode und der
Auferstehung des Herrn“ von Franz Herwig.
5. April
Der aus Essen geflohene Zentralrat der Arbeiterräte
im Ruhrgebiet wies von Barmen aus die Angehörigen
der Roten Armee an, sich ins besetzte Gebiet in
Sicherheit zu bringen.
5. April
In Moskau endete der 9. Kongress der Kommunistischen
Partei Sowjetrusslands, der seit dem 29. März tagte.
Der Volkskommissar für Verteidigung, Leo D. Trotzki,
sprach sich für ein Milizsystem bei der Armee aus.
Er war der Meinung dadurch könnte verhindert werden,
dass die Arbeiterklasse vom Heer geschieden wird.
6. April
Als Antwort auf den Einmarsch von Reichswehrtruppen
in die entmilitarisierte ostrheinische Zone wurden
französische Armee-Einheiten in die Städte Frankfurt
am Main, Darmstadt, Hanau und Dieburg und am 7.
April auch nach Homburg verlegt.
6. April
Die Reichswehrtruppen eroberten in den folgenden
Tagen die Städte Dortmund, Essen und Bochum.
7. April
Auf Forderung der Alliierten sollte die deutsche
Regierung die Einwohnerwehren auflösen. Diese waren
nach dem Ende des Weltkrieges aus Freiwilligen
entstanden und waren meist militärisch organisiert.
7. April
General Anton I. Denikin trat vom Oberkommando der
antibolschewistischen „weißen“ Truppen in Russland
zurück. Sein Nachfolger wurde General Pjotr N. Baron
von Wrangel.
8. April
In Berlin fanden Verhandlungen zwischen
Reichskanzler Hermann Müller (MSPD), Vertretern der
einzelnen Ministerien und Abgesandten politischer
Parteien statt, um über die Besetzung des Gebietes
südlich der Ruhr durch Reichswehrtruppen zu beraten.
8. April
Die Zuständigkeit des Reichsgerichts bei
Streitigkeiten über die Vereinbarkeit der
Ländergesetze mit dem Reichsrecht wurde durch ein
Gesetz geregelt.
8. April
Hermann Kasack veröffentlichte die Erzählung „Die
Heimsuchung“, Hanns Johst das Drama „Der König“ und
Hans Fallada „Der junge Gondschal“.
9. April
Das US-amerikanische Repräsentantenhaus
verabschiedete mit 243 gegen 150 Stimmen einen
Entschluss, den Kriegszustand mit dem Deutschen
Reich zu beenden. Der US-Senat beriet am 15. März
über den modifizierten Entschluss.
9. April
Der US-Senat billigte mit 46 gegen 8 Stimmen den
Gesetzentwurf über freiwillige Anwerbung von
US-Militär anstatt einer Dienstpflicht. Männer
zwischen 18 und 28 Jahren sollten demnach eine
viermonatige Ausbildung erhalten. Das Gesetz wurde
erst 1922 wirksam.
10. April
Bei einer süddeutschen Ministerkonferenz unter
Beteiligung von Bayern, Württemberg, Bade, Sachsen
und Hessen wurde die Auflösung der Einwohnerwehren,
die von den Alliierten am 7. April geFordert worden
war, abgelehnt. Der französische Einmarsch wurde
verurteilt.
10. April
Um den Konflikt zwischen dem Landtag und der
Regierung von Gotha zu lösen, setzte der
Reichspräsident einen Reichskommissar ein und
verhängte den Ausnahmezustand.
10. April
Der Gesamtbund der Christlichen Gewerkschaften gab
auf einer Tagung in
Köln angesichts des
Kapp-Putsches vom 13. März eine Erklärung zugunsten
der Weimarer Verfassung ab. Von diesen
Gewerkschaften wurden rund 1,08 Millionen Mitglieder
im Deutschen Reich vertreten.
10. April
In den USA begann ein siebentägiger
Eisenbahnerstreik. Die US-Regierung stand den
Arbeitern die Einrichtung eines Eisenbahnamtes zur
Schlichtung von Arbeitskonflikten zu.
11. April
Der Groß-Berliner Verband der KPD beschloss, an den
bevorstehenden Reichstagswahlen teilzunehmen. Die
Kommunisten wollten dabei für die Einführung des
Rätesystems im Deutschen Reich eintreten.
12. April
Erstmals nach dem Kapp-Putsch trat die
Nationalversammlung wieder in Berlin zusammen. Sie
verabschiedete eine Reihe wichtiger Gesetze wie das
Reichswahlgesetz und das Gesetz über die Wahl des
Reichspräsidenten.
12. April
Der deutsche Politiker Adolf Köster (MSPD) wurde
Reichsaußenminister.
12. April
In Paris fand in der französischen
Abgeordnetenkammer eine Debatte über neue
Steuergesetze statt. Es wurden eine Erhöhung der
Einkommenssteuer, eine Vermögensübertragungsgebühr
und verschiedene indirekte Steuern vorgesehen. Da
Parlament nahm am 29. April diese Gesetze mit 535
gegen 69 Stimmen an.
12. April
In Irland fand ein viertägiger Generalstreik gegen
die schlechten Haftbedingungen der
in London
inhaftierten irischen Unabhängigkeitskämpfer statt.
Der Streik endete am 15. April, nachdem die
britische Regierung Zugeständnisse gemacht hatte.
12. April
Das Schauspiel „Der Geschlagene“ von Wilhelm
Schmidtbonn wurde am Deutschen Schauspielhaus in
Hamburg uraufgeführt.
13. April
Der deutsche Jurist und Politiker Otto Meißner wurde
Leiter des Büros beim
Reichspräsidenten Friedrich
Ebert (MSPD). Später wurde Meißner, der 1923
Staatssekretär wurde, Chef der Präsidialkanzlei
Adolf Hitlers (1934-1945)
13. April
Der Landtag von Braunschweig beschloss seine
Auflösung und Neuwahlen zum 16. Mai.
13. April
In Berlin wurde die Nordstern-Transportversicherung
AG gegründet. Sie hatte ein Aktienkapital von 5
Millionen Mark.
13. April
In den Kammerspielen in Berlin führte Max Reinhardt
das Bühnenstück „Stella“ von Johann Wolfgang von
Goethe mit Helene Thimig und Agnes Strauf in den
Hauptrollen auf.
14. April
Auf Anregung der Deutschen Demokratischen Partei
(DDP) wurde ein Reichsausschuss für Handel,
Industrie und Gewerbe gebildet unter dem Vorsitz des
Unternehmers Carl Friedrich von Siemens und dem
Bankier Hjalmar Schacht, der später
Reichsbankpräsident wurde.
14. April
Der Präsident des Reichsverbandes der Industrie,
Dr.-Ing. e.h. Kurt Sorge, eröffnete in Berlin die
erste Jahresversammlung des 1919 gegründeten
Reichsverbandes der Industrie. Im Mittelpunkt der
Versammlung stand die Sozialisierungsfrage im
Deutschen Reich und die Import- und Exportprobleme.
14. April
In Bremen begann der 7. Deutsche Seeschifffahrtstag.
14. April
Wegen der unsicheren politischen Lage wurde die
Danziger Herbstmesse abgesagt.
14. April
Die Brotpreise stiegen wegen der Erhöhung des
Mehlpreises um etwa 70 Prozent.
15. April
Der österreichische Außenminister Karl Renner (SPÖ)
kehrte von einem elftägigen Italienbesuch zurück.
Bei seinen Gesprächen mit der italienischen
Regierung ging es um die Aufnahme von
Friedensbeziehungen und die Umsetzung des Vertrages
von St. Germain.
15. April
Das Deutsche Reich zahlte im laufenden Haushaltsjahr
7,75 Milliarden Mark an Zuschüssen für Lebensmittel.
15. April
Bei den Wahlen zur konstituierenden Versammlung in
Litauen erreichten die Christlichen Demokraten mit
59 von 112 Sitzen die absolute Mehrheit.
Zweitstärkste Partei wurden die Volkssozialisten mit
29 Sitzen vor den Sozialdemokraten mit 14 Sitzen.
Die nationale Rechte um Staatspräsident Antanas
Smetona konnte keinen Sitz erringen.
15. April
Die britischen Bergarbeiter sprachen sich in einer
Urabstimmung gegen einen Streik aus. Die britische
Regierung hatte in London einen 20 prozentigen
täglichen Lohnvorschuss für alle Arbeiter über 18
Jahre zugestanden.
15. April
Ein Lohngeldraub in South Braintree im
US-Bundesstaat Massachusetts, bei dem zwei Männer
ermordet wurden, führte zum sogenannten
Sacco-Vanzetti Fall, der weltweit Aufsehen erregte.
16. April
Der rechtsradikale deutsche Politiker Wolfgang Kapp,
der den nach ihm benannten Putsch vom 13. März
mitgetragen hatte und der sich selbst zum
Reichskanzler ernannt hatte, wurde in
Schweden
verhaftet, aber nicht ausgeliefert.
17. April
Zufolge eines in Paris veröffentlichten Dekrets
stellt Frankreich die Handelsfreiheit mit den
Ländern Mitteleuropas, die dem allgemeinen Zolltarif
unterworfen sind, wieder her.
18. April
Odin Hannover gewann das Endspiel um die deutsche
Rugby Meisterschaft gegen den Sportklub Frankfurt am
Main 1880 mit 8:0 Punkten. Die drei Treffer für
Hannover fielen erst kurz vor Schluss.
18. April
Am Großen Schauspielhaus in Berlin inszenierte Karl-
Heinz Martin das Schauspiel „Antigone“ von Walter
Hasenclever mit Gertrud Eysoldt und Emil Jannings in
den Hauptrollen.
19. April
Das Deutsche Reich und Sowjetrussland
unterzeichneten ein Abkommen über die Rückführung
von Kriegsgefangenen. Es war das erste offizielle
Abkommen zwischen den beiden Staaten.
19. April
In San Remo fand eine achttägige Konferenz des
Obersten Rats der Alliierten statt. Die
Mandatsgebiete im Nahe Osten wurden aufgeteilt.
Großbritannien erhielt ein Mandat für Palästina, das
es 1917/18 erobert hatte. Die Teilnehmer der
Konferenz stellte fest, dass die deutsche Regierung
die Verpflichtungen aus dem Versailler Vertrag bei
der Entwaffnung und den Reparationsleistungen nicht
erfüllt hatte.
19. April
Die deutsche Nationalversammlung billigte das Gesetz
über die Grundschulen und die Aufhebung der
Vorschulen. Danach war die Volksschule in den ersten
vier Jahrgängen die für alle gemeinsame Grundschule,
über die der Weg in die mittleren und höheren
Schulen führte.
20. April
In Berlin fand die 48. Vollversammlung des Deutschen
Landwirtschaftsrates statt. Der Vorsitzende, der
frühere preußische Landwirtschaftsminister, Klemens
von Schorlemer-Lieser, wandte sich bei der Begrüßung
gegen dirigistische Eingriffe in die Landwirtschaft.
20. April
Vor der Reichstagswahl Forderte die USPD unter
anderem die Entwaffnung und Auflösung aller
gegenrevolutionären Formationen, die Bestrafung
aller am Kapp-Putsch Beteiligten, die Durchführung
von Sozialisierungsmaßnahmen und ein hartes Vorgehen
gegen Lebensmittelwucher.
20. April
Im Eispalast von Antwerpen in Belgien begannen die
inoffiziellen Winterwettbewerbe der Olympischen
Spiele. Hier fanden bis Ende des Monats die
Eiskunstlauf-Wettbewerbe und ein Eishockey-Turnier
statt, das gleichzeitig die erste Weltmeisterschaft
im Eishockey war. Die offizielle Eröffnungsfeier der
Olympischen Spiele sollte am 14. August, dem Beginn
der Leichtathletik-Wettkämpfe stattfinden.
20. April
In Köln fand die erste Dada-Veranstaltung mit Arp,
Baargeld und Max Ernst statt. Die Ausstellung „Dada-Vorfrühling“
wurde von der Polizei geschlossen. Nach Protesten
wurde sie wieder eröffnet.
21. April
In Rosenheim gründete Adolf Hitler die erste
NS-Ortsgruppe außerhalb Münchens.
21. April
Der polnische Staatspräsident Josef Klemens
Pilsudski schloss mit Simon W. Petljura, dem
nominalen Regierungschef der antibolschewistischen
Ukrainischen Volksrepublik, einen Angriffspakt zur
Eroberung der Ukraine. Das Abkommen zusammen mit
einer Militärkonvention, die drei Tage später
vereinbar wurde, diente der Vorbereitung des
Polnisch-Russischen Krieges.
21. April
In Linz begann die zweite österreichische
Länderkonferenz. Sie sollte eine Verständigung über
die Richtlinien für die künftige österreichische
Verfassung herbeiführen. Ein neuer Entwurf, der vom
Minister für Verfassung- und Verwaltungsreform,
Michael Mayr, aufgearbeitet worden war, sah eine
Direktwahl des Bundespräsidenten durch das Volk für
fünf Jahre vor. Bei der Erörterung des Entwurfs kam
es erneut zu tief greifenden Differenzen zwischen
den Sozialdemokraten und den Christlich Sozialen.
21. April
Im Deutschen Theater in Berlin wurde die Tragödie
„Himmel und Hölle“ von Paul Kornfeld in der Regie
von Ludwig Berger mit Agnes Straub und Werner Krauss
in den Hauptrollen uraufgeführt.
21. April
In Düsseldorf wurde das ernste Spiel „Die Liebe
Gottes“ von Hermann von Boetticher uraufgeführt.
22. April
Der sächsische Ministerpräsident Georg Gradnauer (MSPD)
trat nach Meinungsverschiedenheiten innerhalb seiner
Partei zurück. Sein Nachfolger wurde am 4. Mai der
MSPD-Politiker Wilhelm Buck. Die USPD lehnte auf
einem Landesparteitag in Leipzig am 26. April eine
Beteiligung an der Regierung ab.
22. April
Im Staatstheater in Berlin wurde die Tragödie „Alkestis“
von Robert Prechtel uraufgeführt. Sie wurde nach
einem Monat und nur sechs Vorstellungen wieder
abgesetzt.
23. April
Zwischen Deutschland und Belgien wird eine
Vereinbarung zur Überleitung der Rechtspflege in
Eupen und Malmedy unterzeichnet.
23. April
Die Große Nationalversammlung des Osmanischen Reichs
bildete in Ankara eine türkische Gegenregierung und
verkündete eine vorläufige Verfassung. Mustafa Kemal
Pascha (Seit 1934 als Kemal Atatürk bekannt) wurde
zum Präsidenten der Nationalversammlung gewählt.
23. April
Die deutsche Nationalversammlung verabschiedete in
Berlin das Reichswahlgesetz, die Reichswahlordnung
und das Gesetzt über die Wahl des Reichspräsidenten.
Die Weimarer Reichsverfassung sieht eine Wahl des
Reichspräsidenten durch das ganze Volk für eine
Amtszeit von sieben Jahren vor. Der am 11. Februar
1919 von der Nationalversammlung gewählte Friedrich
Ebert blieb aufgrund von Reichstagsbeschlüssen bis
zu seinem Tod im Jahr 1925 im Amt.
23. April
Die deutsch Reichsregierung ließ aufgrund der
sogenannten Reichsexekution die Landesversammlung
von Sachsen-Gotha durch Reichskommissar Wilhelm
Holle auflösen.
23. April
In Paris wurde der französische
Finanzwissenschaftler und Politiker Joseph Caillaux
wegen „Begünstigung defätistischer Stimmungen“
während des Weltkrieges zu drei Jahren Gefängnis
verurteilt. Er hatte auf eine Beendigung des Krieges
gedrängt und war 1918 auf Betreiben von
Ministerpräsident George Clemenceau verhaftet
worden.
23. April
In Prag wurde die Oper „Die Ausflüge des Herrn
Broucek“ des tschechischen Komponisten Leoš Janácek
uraufgeführt.
24. April
Das preußische Kabinett billigte den Berlin einen
Gesetzesentwurf über die Aufhebung der
Standesvorrechte. Damit entfielen die
Adelsprivilegien. Die Adeligen wurden künftig dem
allgemeinen öffentlichen und bürgerlichen Recht
unterstellt.
24. April
In Berlin wurde ein Entwurf des preußischen
Kultusministeriums zur Neuregelung des
Studentenrechts veröffentlicht. Aufgrund
demokratischer Elemente wurde er von der
deutschnationalen Presse heftig kritisiert.
24. April
Deutschland und Frankreich schließen Abkommen zur
Überleitung der Verwaltungsübergabe in
Elsass-Lothringen.
24. April
In Darmstadt wurde das Lustspiel „Der Trostpreis“
von Otto Stockhausen uraufgeführt.
24. April
In München wurden erstmals Werke des deutschen
Malers und Grafikers George Grosz ausgestellt. Der
26-jährige Dadaist veröffentlichte außerdem 1920
sein Mappenwerk „Gott mit uns“.
25. April
Der deutsche Flugzeugkonstrukteur Claude Dornier
musste auf Forderung der Alliierten das
Verkehrsflugboot GS I vernichten. Er hatte zuvor die
Maschine in Amsterdam präsentiert.
25. April
Im thüringischen Kleinstaat
Schwarzburg-Sondershausen erhielt die USPD bei einer
Volksabstimmung ein Vertrauensvotum.
25. April
In Berlin erschien die Illustrierte Zeitschrift „dada
3“ und in Köln „Die Schammade“, an der als Dadaisten
Max Ernst und Erwin Hoerle mitwirkten.
26. April
Die polnische Armee begann unter Führung von
Marschall Josef Klemens Pilsudski den Einmarsch in
die Ukraine.
26. April
Die sächsische SPD beschloss auf einem
Landesparteitag in Meißen, an der bisherigen
Koalition festzuhalten. Die USPD lehnte in Leipzig
eine Beteiligung an der Regierung ab.
27. April
Vom preußischen Landtag wurde das Gesetz über die
Schaffung von Groß-Berlin gebilligt. Die Städte
Charlottenburg, Köpenick, Lichtenberg, Neukölln,
Schöneberg, Spandau und Wilmersdorf, 59 Dörfern und
29 Gutsbezirken bildeten die Reichshauptstadt Berlin
mit rund 3,86 Einwohnern und einer Fläche von 878
km².
28. April
Die Lebensmittelversorgung von Hamburg, Berlin und
Dresden wurde durch einen Streik der Binnenschiffer
auf Elbe und Oder beeinträchtigt.
28. April
Das US-amerikanische Repräsentantenhaus und der
Senat sprachen sich für eine Wiederaufnahme der
Handelsbeziehungen mit dem Deutschen Reich aus, die
durch den Weltkrieg unterbrochen worden waren.
28. April
In Dresden wurde die heitere Oper „Schirin und
Gertraude“ von Paul Graener uraufgeführt.
29. April
Der Reichsrat gab seine Zustimmung für die Bildung
des Reichswirtschaftsrates.
29. April
Die Nationalversammlung billigte das
Reichsheimstättengesetz und das Tumultschädengesetz.
29. April
Alle Parteien waren mit der Wiederaufnahme der
Verfahren der außerordentlichen Kriegsgerichte
einverstanden.
29. April
In Aserbaidschan wurde nach einem erfolgreichen
bolschewistischen Aufstand eine Sowjetverfassung
eingeführt. Am 27. April wurde Aserbaidschan, in dem
bisher Mehmet Emin Resulzade als Präsident des
Nationalrates regiert hatte, Sowjetrussland
angegliedert.
30. April
Alle betroffenen Parlamente ratifizierten das Gesetz
zur Bildung des Landes Thüringen, das zum 1. Mai in
Kraft trat.
30. April
Die preußische Gesandtschaft im Vatikan wurde von
der deutschen Reichsregierung in eine
Reichsbotschaft umgewandelt. Diego von Bergen, seit
Mai 1919 preußischer Gesandter beim Vatikan, wurde
auch erster Botschafter des Deutschen Reiches.
30. April
Der Termin für die Reichstagswahl wurde vom
Reichspräsidenten auf den 6. Juni festgelegt.
30. April
In Frankfurt am Main wurde ein zweitägiger
Wirtschaftskongress eröffnet, um über Probleme mit
der Rohstoffversorgung und der wirtschaftlichen
Konsolidierung Europas zu beraten.
Wer
hat im April 1920 Geburtstag >>
April 1920 in den Nachrichten
....
>>>
Werbung
<< Das
geschah 1919
|
Das geschah 1921 >>