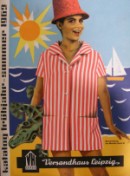DDR Chronik 1963 - Mangel kontra Zuversicht
Der Bau des „Antifaschistischen Schutzwalls“, wie er
in der DDR in offiziellen Kreisen und auch in den
Zeitungen benannt wurde, war noch längst nicht als
selbstverständliche Tatsache in den Köpfen der Menschen
verankert. Dass die Teilung der beiden deutschen Staaten
sich durch die Mauer manifestierte,
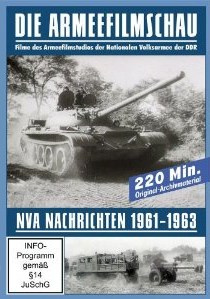
machte sie ebenfalls
nicht zu einem akzeptablen Fakt. Die Menschen hatten in
ihrem Arbeitsalltag zwar genügend Ablenkung, um dem
Sozialismus wirtschaftlich auf die Sprünge zu helfen,
aber sie wurden auch unentwegt mit Propaganda der Partei
konfrontiert. Bei vielen Menschen war die Hoffnung auf
ein friedliches und gerechtes Leben so groß, dass sie
dieser Propaganda Glauben schenkten und emsig bemüht
waren, Bestleistungen anzustreben. Dass der westliche
Teil Deutschlands zum sogenannten „Klassenfeind“
stilisiert wurde, geschah fast unmerklich, aber wirksam.
Dennoch gab es viele Menschen, die eher die Mauer als
feindlich ansahen als die Art der Demokratie, die in der
BRD verwirklicht wurde. Dort hatte inzwischen Konrad
Adenauer (1876-1967) für den seinen Rücktritt
angekündigt, den er im Herbst tatsächlich realisierte.
Ludwig Erhard (1897-1977) wurde sein Nachfolger. In der
DDR herrschte nach wie vor
Walter Ulbricht (1893-1973)
mit diktatorischer Politik. Da war kein Platz für
kritische Äußerungen wie sie beispielsweise Robert
Havemann (1910-1982) in einem Vortrag über marxistische
Philosophie öffentlich aussprach. Das durfte sich nicht
einmal ein Kommunist leisten.
Wer seine Freunde und Verwandten seit dem Mauerbau nicht
mehr gesehen hatte, der konnte wenigstens zum Jahresende
ein wenig jubeln. Das Passierscheinabkommen, das am 17.
Dezember 1963
geschlossen worden war, machte es
Berlinern aus dem Westteil der Stadt erstmals wieder
möglich, in den Ostteil der Stadt einzureisen. Umgekehrt
nicht. Dessen ungeachtet versuchten
immer wieder
Menschen aus der
DDR in den Westen zu fliehen. Das
Westfernsehen informierte über solche Fluchtversuche,
auch über die, die tödlich endeten. Seitens der DDR
wurde so eine Aktion als ein verbrecherischer Akt
gewertet, der zu Strafen berechtigte.
In der Kunst, vor allem auch in dem Bereich Literatur –
Bücher waren sehr preiswert – hatte sich nach dem Bau
der Mauer eine sogenannte „Ankunftsliteratur“ etabliert.
Diese Phase war von dem „Bitterfelder Weg“ geprägt, der
eine neue kulturpolitische Entwicklung bezeichnete,
angelehnt an eine Autorenkonferenz, die im VEB
Chemiekombinat Bitterfeld ihren Anfang genommen hatte.
Die Betriebe gehörten dem Volk und es herrschte auf
höchster Ebene Einigkeit darüber, dass nun auch ein
eigenes Kunstschaffen entwickelt werden musste, das sich
deutlich von der Kunst des Klassenfeindes abzugrenzen
hatte. Das „Künstlerische Volksschaffen“ wurde in den
Zirkeln schreibender Arbeiter gefördert. Damit erhoffte
sich die Parteiführung eine Kunst, die ihrer Linie
entsprach. Es war eine scheinbare Liberalisierung in der
gesamten Kultur- und Jungendszene sichtbar und sogar
Liedermacher wie Wolf Biermann (*1936) durften
öffentlich auftreten. Solange sich kritische Texte in
Grenzen hielten. Selbst die von
Walter Ulbricht
(1893-1973) eigentlich so verteufelte Beatmusik wurde in
gemäßigter Dosierung zugelassen. In einem
Jugendkommuniqué von 1963 hatte die SED ihre neue
Offenheit festgelegt, hatte Selbständigkeit versprochen
und die jungen Leute mit einem Mitspracherecht zu
künstlerischer Arbeit angehalten.
Das Jahr 1963 war besonders für eine Schriftstellerin
von großer Bedeutung –
CHRISTA WOLF
(1929-2011). Ihr
Erzählung „Der geteilte Himmel“ war ein sehr
charakteristisches Beispiel für die neue Literatur in
der DDR, wobei gerade in dieser Veröffentlichung ein
sehr reales Systembild gezeichnet wurde, das noch in
späteren Jahren maßgeblich zur Verarbeitung jener Zeit
beitragen sollte. Christa Wolfs Buch war keineswegs von
Parteipropaganda durchsetzt, sondern fand gerade durch
seinen Wirklichkeitsbezug Anklang.
Entspannung durch Kunst, das war die staatliche
Empfehlung, denn in diesem Jahr wurde in der DDR das
Drei-Schicht-System in den volkseigenen Betrieben
eingeführt, um die Laufzeiten der Maschinen effizient
auszulasten und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, um
das es mehr als schlecht bestellt war. Gleichzeitig
wurde von staatlicher Seite alles getan, um die Betriebe
zu einer Art zweitem Zuhause zu gestalten, in dem man
Betriebssportgemeinschaften förderte oder neu gründete,

Arbeitertheater unterstützte und dabei half, günstig an
Theaterabonnements zu gelangen, um nur einige Beispiele
zu nennen. Auch die Massenorganisationen GST
(Gesellschaft für Sport und Technik) trug dazu bei, das
Interesse junger Menschen an Technik im Zusammenhang mit
Sport zu befriedigen. Allerdings liefen die Aktivitäten
der Organisation auf eine Hinwendung zum Militär und
damit zum Dienst in der Nationalen Volksarmee (NVA)
hinaus. Es war eine vormilitärische Ausbildung, die
bereits in der Schule forciert wurde. Durch die hohe
technische Ausrüstung bot dieser Wehrsport den
Jugendlichen Möglichkeiten, die sie ansonsten nicht
gehabt hätten. Manche Sportart konnte man nur als
Mitglied in der GST ausüben. Das wiederum war preiswert
und verlockend.
Kennzeichnend für das Jahr 1963 war, wie auch schon für
die vorangegangenen Jahre, die schlechte Versorgungslage
im Land. Mangel herrschte an allem. Davon waren
Grundnahrungsmittel und Bekleidung ebenso betroffen wie
Waschmittel, diverse Kosmetika und vieles mehr. Wer
Verwandte in Berlin (West) oder in der Bundesrepublik
hatte, konnte private Engpässe leichter überwinden als
die Menschen, die auf die DDR-Versorgung angewiesen
waren. Auch Baumaterial gehörte zur Mangelware.
Entsprechend lang

waren die Zeiten, bis neue Wohnungen
entstanden oder Ruinen wieder zu bewohnbaren Häusern
wurden. Der Bau der Mauer hatte zwar die
Abwanderungsquote gestoppt, nicht aber den Willen vieler
Menschen gebrochen, in den Westen zu gehen. Und von
offizieller Seite, von den Höhen der SED-Regierung
hallte es wider von Zuversichtsparolen, die sogar eine
Wiedervereinigung thematisierten – durch die
Zerschlagung des Kapitalismus im Westen und einen
Sozialismus in einem vereinten Deutschland. Die
Wirtschaftskonferenz, die am 24. und 25. Juni 1963
stattfand, brachte das „Neue ökonomische System der
Planung und Leitung der Volkswirtschaft“ (NÖSPL) hervor.
Darin war festgelegt, wie der wirtschaftliche Standard
der BRD einzuholen und letztendlich zu überflügeln sei.
Die Umsetzung dauerte lange, 1963 war davon jedenfalls
noch nichts zu spüren.
Merklich spürbar in allem war allerdings der Einfluss
des sowjetischen Bruderlandes, nach dem sich die
DDR-Regierung orientierte und sich in Abhängigkeit
befand. Die „Gesellschaft für deutsch-sowjetische
Freundschaft“ (DSF), die bereits
1949 gegründet worden
war, versuchte als Massenorganisation jegliche
antisowjetische Einstellung in der Bevölkerung
abzubauen, Brieffreundschaften in den Schulen zu
initiieren und eine feste Freundschaft von „oben“ zu
diktieren. Kontakte zu Personen westlich der Grenze
wurden nach wie vor kontrolliert und aufmerksam beäugt.
Auch die „Verordnung zum Schutze der Staatsgrenze
zwischen der DDR und West-Berlin“ sollte derartige
Kontakte und vor allem weitere Fluchtversuche
erschweren, im besten Fall verhindern. Im Klartext hieß
das; die Sperrzone an der Mauer wurde erweitert. Im
Bezirk Potsdam wurde sie auf 500 Meter, in Ost-Berlin
auf 100 Meter ausgedehnt. Außenpolitisch war die DDR
bemüht, internationale Anerkennung zu erlangen, als
souverän zu gelten und sich in allen Bereichen vom
Nachbarn BRD zu unterscheiden. Immerhin hatte Kuba die
DDR anerkannt, was die BRD mit dem Abbruch der
diplomatischen Beziehungen zu dem Inselstaat vor den
Toren der USA quittierte.
Die Mode in jener Zeit hatte ein wenig von ihrer
Damenhaftigkeit eingebüßt, zumal Eleganz und Glamour nur
bedingt zum Frauenbild des Sozialismus passte, was aber
nicht bedeutete, dass die Frauen sich dennoch nach
attraktiver Kleidung sehnten. Ein Muss war für die
werktätige Frau – mittlerweile waren rund 50 % der
Frauen berufstätig – aber nicht nur die Kittelschürze
aus Dederon (im Westen aus Nylon),
sondern vor allen Dingen eine Kleidung der
Zweckmäßigkeit, die Selbstbewusstsein zum Ausdruck
brachte. Schick durfte die Freizeitbekleidung dennoch
sein. Für die jungen Mädchen war
die Rocklänge eher eine Rock-Kürze,
Hosenanzüge waren en vogue und auch Petticoats wurden
getragen. Wenngleich diese Mode der weiten Röcke und
Kleider im Westen schon fast out war, so hatte sie in
den Sechzigern in der DDR durchaus noch Bestand. Wer
sich mit der
Nähmaschine gut auskannte, war klar im
Vorteil. Da war nur noch das Material-Problem.
Die meisten Stoffe waren aus Chemiefasern, nicht sehr
luftdurchlässig, dafür pflegeleicht. Immerhin war eine
effiziente Zeitauslastung etwas, was staatliche
Unterstützung fand. In der Produktion und auch in der
Freizeit. Übrigens, der Modetanz „Lipsi“, der
1959
eigens von staatlicher Seite erfunden worden war, um
sich von amerikanischen Einflüssen zu unterscheiden,
hatte sich bei aller Bemühung um Abgrenzung nicht halten
können. Auch in der DDR tanzte man Twist. Gegen den ging
niemand politisch vor, man duldete ihn, weil er als
harmlos und nicht systemfeindlich eingestuft wurde. Ob
er dennoch ein Tanz auf dem Vulkan war?..
<<
DDR 1962
|
DDR
1964
>>