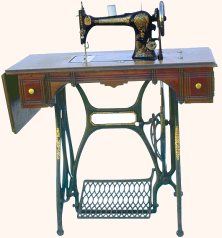Die Geschichte der Nähmaschine
In jedem Haushalt findet sich heutzutage
eine Nähmaschine, die wohl kaum noch eine annähernde
Ähnlichkeit mit den Maschinen aufweist, die ganz am
Anfang der Entwicklung standen. Noch bevor überhaupt
handbetriebene Nähmaschinen genutzt wurden, verwendeten
die
Menschen Fischgräten zum Nähen, formten später aus
Knochen und Hörnern der Tiere spitze Nadeln, die das
Nähen erleichterten. Die erste Stahlnadel wurde erst im
14. Jahrhundert produziert und diente dann auch mehrere
Jahrhunderte weiter als wichtigstes Werkzeug für das
Nähen der Kleidung.
Bis ins 19. Jahrhundert hinein erfreute sich der Beruf
des Schneiders zwar weiterhin großer Achtung, doch die
Industrialisierung hielt auch auf diesem Gebiet Einzug.
1755 konstruierte in England der Deutsche Charles
Frederic Wiesenthal die erste Maschine, die die mühsame
Aufgabe des Nähens übernehmen sollte. Der erste Prototyp
war mit einer beidseitigen Nadel versehen, die ein Öhr
in der Mitte aufwies.
Die Maschinen, die dann nach und nach konstruiert
wurden, waren noch nicht klein und handlich, wie man es
heute gewohnt ist. Im Gegenteil waren sie aufwändig,
meistens auf Holzgerüsten befestigt, mit einer großen
Kurbel ausgestattet.
Während die erste Nähmaschine von Wiesenthal kaum mit
einem guten Schneider konkurrieren konnte, der dreißig
Stiche in der Minute schaffte, baute dann der Tischler
Thomas Saint in
London die nächste, auf die er auch ein
Patent anmeldete. Das Material war hauptsächlich Holz,
die Nadel war gegabelt, mit Vorstecher und Hakennadel
ausgestattet und konnte so Kettenstiche nähen. Auch
diese fand jedoch im Alltag keinen praktischen Nutzen,
alleine der Kettenstich sollte dann in Deutschland seine
Verwendung finden, umgesetzt von Balthasar Krems aus der
Eifel. Dieser konstruierte 1800 die erste
Kettenstichnähmaschine, die mittels eines Stachelrades
schrittweise das Nähgut voranschob. Diese Maschine
schaffte unglaubliche 300 Stiche pro Minute.
In Frankreich wurde dann die erste Fabrik für die
Herstellung von Nähmaschinen gegründet, geleitet von dem
französischen Schneider Barthélemy Thimonnier, dem die
eigene Arbeit einfach zu mühselig und zu langsam von der
Hand ging. Sein Entwurf einer Nähmaschine schaffte zwar
nur 200 Stiche in der Minute, wurde aber von der
Regierung gutgeheißen, die mit dieser Erleichterung der
Arbeit ganz andere Absichten verfolgte, so dass der
Schneider einen Großauftrag in der Herstellung bekam.
Damit ging die Nähmaschine in Serie, wurde dann
hauptsächlich dazu genutzt, um für das Militär schneller
und effektiver Uniformen zu nähen.
Nach der Eröffnung und dem Aufstieg der Fabrik musste
Thimonnier aus Paris flüchten. Gerüchten zufolge soll
seine Fabrik sogar von zweihundert unzufriedenen
Schneidern gestürmt
und zerstört worden sein. Thimonnier
versuchte sein Glück in England, kämpfte aber auch dort
mit zahlreichen Schwierigkeiten. Trotz seiner Erfindung
und dem Erfolg, starb er in großer Armut.
Ihm folgten weitere Erfinder, die ein ähnliches
Schicksal teilten, die Konstruktion zwar voranbrachten
und verbesserten, jedoch davon einfach nicht leben
konnten, teilweise, weil die Öffentlichkeit die
Maschinen nicht gut aufnahm und schon gar nicht kaufte,
teilweise, weil sie schnell wieder den Geist aufgaben
oder gar nicht zum Laufen gebracht werden konnten, wie
bei dem Amerikaner Walter Hunt, der die erste Maschine
entwarf, die mit zwei Fäden nähen sollte.
Etwas anders erging es dem Amerikaner Elias Howe. Er
gilt als der Erfinder der Doppelsteppstichnähmaschine
und ihm wird die eigentliche Entwicklung zugesprochen.
Auch sein Antrieb war die Armut, die Not seiner Familie,
die er kaum schaffte, durchzubringen. Durch das
Beobachten der Nähhandbewegung seiner Frau gelangte er
zu der Idee, eine Maschine zu erfinden, die ihr die
Arbeit erleichtern könnte. Sein fertiges Modell erregte
einiges Aufsehen, doch als es an das Verkaufen ging,
wollte keiner den Preis zahlen. Auch fürchtete man zu
dieser Zeit die Wut der Schneidergilde.
Howe hatte bis dahin schreckliches Pech. Die Armut
ermöglichte ihm nicht, ein Patent anmelden zu können. Er
zog von Amerika nach England, wo er sich mehr Erfolg
erhoffte, was nicht der Fall war. Bei seiner Rückkehr
hatte der einstige Mechaniker und nun reiche
Geschäftsmann Isaac
Singer bereits eine eigene Maschine
erfunden und patentieren lassen. Diese wurde wesentlich
günstiger verkauft und Howe reichte Klage ein, die ihm
dann auch vom Gericht bewilligt wurde. Der Verdienst
Singers musste geteilt werden, Howe wurde so doch noch
zu einem reichen Mann.
Die Herstellung von verschiedensten Nähmaschinen fand
schließlich auch in Europa Absatz. Da sein Vater ihm die
Arbeit in der Schmiede untersagte, baute z. B.
Adam Opel
innerhalb von acht Monaten seine erste Nähmaschine in
einem angrenzenden Kuhstall. In der Schweiz wiederum
erfand Fritz Gegauf die erste Hohlsaummaschine, gründete
dann auch eine Firma, die bis heute Nähmaschinen baut,
die 1930 unter dem gleichen Markennamen laufen -
BERNINA.
Die erste elektrische und transportable Nähmaschine
wurde 1940 in Genf von der Firma Tavaro S. A. gebaut.
Immer mehr Firmen interessierten sich für die
Herstellung der Nähmaschine, darunter waren Namen wie
Adler, Köhler, Opel und Phoenix. Die einfache
Haushaltsnähmaschine mit Antriebsriemen fand großen
Umsatz, wird heute natürlich nicht mehr hergestellt.
Moderne Nähmaschinen sind aus Plastik, computerisiert,
haben mehrere Nähprogramme, weisen einen
Elektronik-Stop-Motor auf und können u. a. automatisch
einfädeln oder per Touchscreen bedient werden. Die
klobigen, aus Holz oder Metall gebauten Nähmaschinen
kann man heutzutage nur noch in den verschiedenen Museen
der Städte bewundern, in denen sie entworfen wurden. Sie
besitzen einen nostalgischen Wert und geben Aufschluss
darüber, wie mühsam ihre eigene Geschichte gewesen ist.