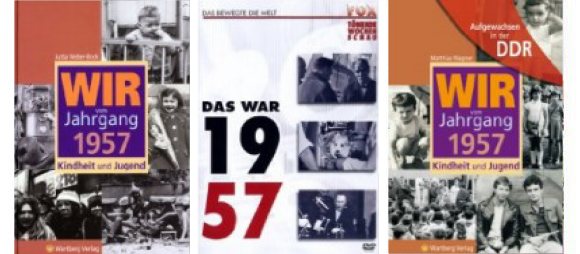Literatur 1957 - Das literarische Jahr 1957
1957 begann der Wettstreit der wissenschaftlichen
Weiterentwicklungen und Errungenschaften. Russland
gegen Amerika. Großmacht gegen Großmacht. Die
Sowjetunion legte vor. Der Satellit „Sputnik“ wurde
ins All geschickt, dazu eine erste
Interkontentalrakete. Die USA witterten überall
kommunistische Unterwanderungen und erließen
Gesetze, um dagegen vorzugehen. Spione bevölkerten
die Welt.
Im Osten Deutschlands machte man sich an den Aufbau
des Sozialismus. Zu viele Menschen flüchteten und
verließen die DDR, das Wort „Republikflucht“ wurde
ins Leben gerufen, das Verlassen des Landes
bestraft.
Sein Land zu verlassen, kam für Jack Kerouac erst
einmal nicht in Frage. „On the road“ erschien, sein
Roman über das Trampen am Wegesrand, die Suche nach
Freiheit und der Sehnsucht nach dem Abenteuer. Mit
diesem literarischen Wurf ahnte Kerouac noch nicht,
dass er damit eine neue literarische Bewegung
einleitete und eine ganze Generation prägte, damit
ein Bild von sich schuf, das ihn mitunter auch
zerstören sollte. Nicht nur, dass Kerouac weiterhin
an großer Geldnot litt, so trank er aus Frust auch
viel Alkohol, nahm Drogen und fand keinen Halt im
Leben. Auf der Welle der Beat-Generation, den Partys
und verzweifelten Versuchen, sich lebendig zu
fühlen, wurde die Bewegung allmählich
kommerzialisiert. Kerouac floh vor dem eigenen Bild,
das man sich von ihm machte, flüchtete in das Haus
seiner Mutter in Florida. Doch auch dort fand er
keine Ruhe, trank und nahm Drogen und starb
schließlich mit 45 Jahren an den Folgen eines
solchen Lebenswandels. Sein Buch „On the road“
überdauerte auch die Beat-Zeit. Eines der schönsten
Zitate ist das über die Verrückten:
„Denn die einzig wirklichen Menschen sind für mich
die Verrückten, die verrückt danach sind zu leben,
verrückt danach zu sprechen, verrückt danach, erlöst
zu werden, und nach allem gleichzeitig gieren -
jene, die niemals gähnen oder etwas Alltägliches
sagen, sondern brennen, brennen, brennen wie
phantastische gelbe Wunderkerzen.“
Von dem russischen Dichter Boris Pasternak, dem ein
Jahr später unter etwas fragwürdigen Voraussetzungen
der Literaturnobelpreis zukam, erschien das
beeindruckende Werk „Doktor Schiwago“, zunächst noch
in einer italienischen Übersetzung. Es blieb sein
erster und einziger Roman als eine Sehnsucht, den
Alltag einzufangen. Durch die Umstände in der
Sowjetunion hatte das Manuskript einen langen Weg
hinter sich und durfte dort bis 1988 nicht
öffentlich erscheinen, kursierte natürlich im
Samisdat. Pasternak hatte das Manuskript einem
Agenten von Feltrinelli übergeben, der es über die
Grenze bis nach Italien schmuggelte. 1958 erschien
dann die russische Originalversion.
Auch Vladimir Nabokov ließ wieder von sich hören.
1957 erschien sein Roman „Pnin“, der sich explizit
mit den Schwierigkeiten des Emigranten in einem
fremden Land auseinandersetzte. Pnin, ein kauziger
Gelehrter und College-Professor, erscheint den
Menschen durch seine Eigenarten und
Sprachschwierigkeiten lächerlich und verrückt,
während sein geistiges Potential sicherlich den
Horizont vieler übersteigt, die hinter seinem Rücken
über ihn schmunzeln. Nabokov gelang mit diesem Roman
ein humoriges und gleichzeitig tragisches Buch samt
einer Figur, die in der Erinnerung bleibt.
Ayn Rand brachte 1957 ihren Roman „Altas wirft die
Welt ab“ heraus. Darin entwickelt sie ihre bis heute
gefragte Philosophie des Objektivismus, hebt
Kapitalismus als wichtige Bedingung hervor, zeigt
den nach Erfolg strebenden Menschen als tragenden
Bestandteil einer funktionierenden Gesellschaft,
macht aus dem Egoismus eine Tugend und erklärt den
Verstand zum Maß der Dinge. Damit wurde das Buch
politisch und gerade in Amerika äußerst
einflussreich.
Innerhalb Deutschlands blieb die Literatur
gespalten. In der DDR setzten sich die
Schriftsteller hauptsächlich mit dem Sozialismus und
Antifaschismus auseinander, die Literatur sollte dem
Aufbau der DDR dienen und geeignet erziehen. Dabei
wurde den Schriftstellern nicht nur vorgeschrieben,
was und worüber sie zu schreiben hatten, sondern
auch dem Leser, was er lesen durfte. Die Zensur
spielte eine tragende Rolle in der Erziehung hin zum
Sozialismus.
Im Westen wurde zeitkritische Literatur häufig in
Form von Satire ausgedrückt, so bei
Martin Walser in
seinem Roman „Ehen in Philippsburg“, bei Hans Magnum
Enzensberger in „Die Verteidigung der Wölfe“ oder
bei Arno Schmidt in seinem Roman „Die
Gelehrtenrepublik“. Eine kritische
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit fand
weniger statt.
Der Literaturnobelpreis ging 1957 an den Franzosen
Albert Camus für seinen Blick auf die Missstände und
die Darstellung der Gewissensprobleme jeglicher Art.
Der Schriftsteller und Philosoph des Absurden kam
genauso absurd ums Leben, drei Jahre später, als
Beifahrer bei einem Autounfall.
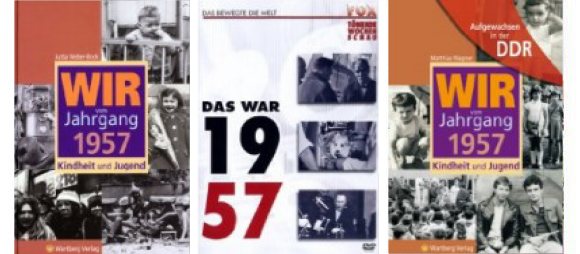
<<
Literatur 1956
|
Literaturjahr
1958 >>