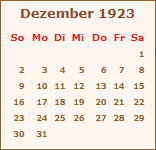Dezember 1923 - Deutsche Auswanderung und
deutsche Separatisten
Vorübergehend wurde die deutsche Auswanderung
in den USA bis zum Juni 1924 unterbunden. Die
Deutschen hatten im Krisenjahr 1923 ihre Quote
erschöpft. Nur ein festgelegter Prozentsatz der
schon ansässigen Angehörigen einer Nation durfte neu
einwandern.
Die französische Tageszeitung „L’Humanité“
veröffentlichte Details über die französische
Unterstützung der deutschen Separatisten. In Landau
in der Pfalz zum Beispiel waren diese zu 75 Prozent
mit französischen Gewehren bewaffnet gewesen.
<<
November 1923
|
Januar
1924 >>
Wichtige Ereignisse im
Dezember 1923
1. Dezember
Reichsverkehrsminister Rudolf Oeser schloss mit der
französisch-belgischen Eisenbahnregie das erste
Mainzer Abkommen (das Zweite am 16. Dezember), das
dafür sorgte, dass der Eisenbahnverkehr zwischen dem
besetzten Rhein- und Ruhrgebiet und dem unbesetzten
Deutschen Reich wiederaufgenommen werden konnte.
1. Dezember
In Treptow kam es zu einer gewaltsamen
Auseinandersetzung zwischen Arbeitslosen und
Schutzpolizei. Verletzt wurde niemand.
1. Dezember
Der Parteitag der sächsischen SPD sprach mit großer
Mehrheit der Reichstagsfraktion und dem
Hauptvorstand der Partei in Berlin das Misstrauen
aus. Gegen die „barbarische Willkür und den
Militärterror“ der Reichswehr erhob er einstimmig
Protest.
1. Dezember
23,4 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder waren
arbeitslos. 50,4 Prozent waren Kurzarbeiter.
1. Dezember
467 Rundfunkteilnehmer sind gemeldet.
1. Dezember
Die Löhne der Arbeiter beim Deutschen Reich und den
Ländern wurden in Goldmark festgesetzt.
1. Dezember
Martin Buber erhielt einen Lehrauftrag für jüdische
Religionswissenschaft und Ethik an der Universität
in Frankfurt am Main.
2. Dezember
In Berlin kosteten ein Kilogramm Kartoffeln 90
Milliarden Mark, ein Ei 20 Milliarden Mark, ein
Liter Milch 360 Milliarden Mark und ein Pfund Butter
2800 Milliarden Mark.
3. Dezember
Nach der Verhaftung von drei an den Krakauer Unruhen
vom 6. bis 8. November beteiligten
Parlamentsabgeordneten der polnischen
sozialistischen Partei suchten die Sozialisten die
Zusammenarbeit mit den nationalen Minderheiten.
3. Dezember
Der Stahlbund wurde aufgelöst.
4. Dezember
Reichskanzler Wilhelm Marx begründete in seiner
Regierungserklärung die Forderung nach einem
Ermächtigungsgesetz mit der katastrophalen
wirtschaftlichen Lage des Deutschen Reiches.
4. Dezember
Der britische Wahlkampf war auf dem Höhepunkt.
Täglich wurden ungefähr 15 000 Wahlveranstaltungen
abgehalten. Die Parteien hatten Flugzeuge gemietet,
um ihre Spitzenkandidaten schneller zu den
Wahlversammlungen transportieren zu können.
4. Dezember
Der Durchschnittslohn eines Maurers lag knapp über
dem Existenzminimum.
4. Dezember
Die Gewerkschaften Forderten Hilfe vom
Reichsarbeitsminister gegen die Lohnpolitik der
Unternehmerverbände.
4. Dezember
Die Komödie „Vinzenz oder die Freundin bedeutender
Männer“ von Robert Musil wurde im Lustspielhaus in
Berlin uraufgeführt. Musil erhielt dafür und für die
„Schwärme“ (1921) den Kleist Preis 1923.
5. Dezember
Im braunschweigischen Landtag setzten die
Linksparteien gegen den Widerstand der bürgerlichen
Parteien ein Ermächtigungsgesetz durch, das die
Staatsregierung dem ständigen Abberufungsrecht des
Landtages unterwarf.
5. Dezember
Die Vertreter des Zechen-Verbandes und der Arbeno
beschlossen, in Arbeitszeit- und Lohnfragen in
Zukunft gemeinsam vorzugehen. In Kokereien und
entsprechenden Bergbaubetrieben sollte die
zwölf-Stunden-Schicht wieder eingeführt werden.
5. Dezember
Die Untersuchung des Münchener Professors Lujo
Brentano lautete „Der Ansturm gegen den
Achtstundentag“.
5. Dezember
Der Film „Der verlorene Schuh“ nach dem Aschenputtel
Märchen mit Motiven von E.T.A. Hoffmann und Brentano
wurde im Ufa-Palast am Zoo in Berlin uraufgeführt.
Zu den Hauptdarstellern zählten Paul Hartmann, Lucie
Höflich, Olga Tschechowa und Hermann Thimig.
6. Dezember
Bei den Parlamentswahlen in Großbritannien gewannen
die liberale Partei und die Labour Party auf Kosten
der regierenden Konservativen eine erhebliche Anzahl
von Mandaten.
6. Dezember
Die in Brasilien lebenden Deutschen hatten bisher
über 70 000 Goldmark für Notleidende im Deutschen
Reich gespendet.
6. Dezember
Der Roman „Anton und Gerda“ von Hans Fallada
erschien beim Rowohlt-Verlag in Berlin.
7. Dezember
In Thüringen erklärte das Minderheitskabinett unter
August Frölich (SPD) seinen Rücktritt.
7. Dezember
Der Präsident des statistischen Reichsamtes Ernst
Delbrück, der dieses Amt seit 1912 leitete, ging in
den Ruhestand.
7. Dezember
Die erste Steuernotverordnung wurde erlassen. Sie
beinhaltete eine Übergangsregelung für die Zahlung
der Umsatzsteuer und der Rhein-Ruhr-Abgabe in neuer
Währung (Rentenmark)7. Dezember
Arbeno und besonders geladene Eisen- und
Stahlindustrielle treffen in Essen zusammen, um über
ihre künftige Politik zu beschließen.
7. Dezember
Täglich wurden 100 Millionen Rentenmark gedruckt,
insgesamt waren es bisher eine Milliarde.
8. Dezember
Das Ermächtigungsgesetz zur Behebung der Not von
Volk und Reich wurde vom Reichstag gegen die Stimmen
von DNVP und KPD angenommen. Das Gesetz hatte eine
feste Laufzeit bis zum 15. Februar 1924. Der
Reichstag löste sich auf unbestimmte Zeit auf.
8. Dezember
Die Erzeuger und Verarbeiter kamen überein, eine
öffentliche Auseinandersetzung in der Zollfrage so
lange zu vermeiden, bis sich die wirtschaftliche
Lage geklärt habe.
8. Dezember
Die Hälfte der Bevölkerung von Duisburg erhielt
Arbeitslosenunterstützung. Die Stadt überschritt
damit die vorgeschriebenen Sätze und die Zahlungen
von der Reichsregierung wurden gesperrt.
8. Dezember
In Essen lehnt eine außerordentliche
Generalversammlung der christlichen Bergarbeiter
eine Verlängerung der Arbeitszeit ab, empfahl jedoch
zur Vermeidung von Aussperrungen, die Überstunde zu
verfahren.
8. Dezember
Das Drama „Baal“ von Bertolt Brecht wurde im Alten
Theater in Leipzig uraufgeführt. Die Aufführung
löste heftige Kritik aus und das Stück wurde auf
Anordnung des Oberbürgermeisters sofort abgesetzt.
9. Dezember
Die Rheinlandkommission hob die meisten der von ihr
verfügten Beschränkungen des Eisenbahn-, Auto- und
Straßenbahnverkehrs auf.
10. Dezember
Die Franzosen lockerten ihr Besatzungsregime im
Ruhrgebiet langsam durch Reduzierung der Truppen,
Aufhebung von Ausweisungen und Entlassung von
Verurteilten.
10. Dezember
In Stockholm wurden die diesjährigen Nobelpreise für
Medizin, Chemie, Physik und
Literatur verliehen. Die
Entscheidung des Nobelpreiskomitees für die Sparte
Medizin stieß auf allgemeines Unverständnis und
erregte heftige Kritik.
11. Dezember
Die Bemühungen des türkischen Präsidenten Mustafa
Kemal Pascha (später Atatürk), den türkischen Staat
zu säkularisieren, führte zu Unruhe unter der
islamischen Geistlichkeit auch außerhalb der Türkei,
vor allem in Britisch-Indien.
11. Dezember
Das Reichspostministerium in Berlin und die
Obertelegrafen Direktion in Bern testeten eine
Chiffriermaschine hinsichtlich ihrer Eignung für die
Geheimhaltung drahtlos übermittelter Nachrichten.
Der Austausch chiffrierter Telegramme war
erfolgreich.
11. Dezember
Das Drama „Debureau“ von Melchior Vischer wurde im
Schauspielhaus in Frankfurt am Main uraufgeführt.
12. Dezember
US-Präsident Calvin Coolidge gab die Beteiligung von
nicht amtlichen US-Finanzexperten an den von der
Reparationskommission zu berufenen
Sachverständigenausschüssen zur Untersuchung der
Finanzlage des Deutschen Reiches bekannt. Bisher
hatte sich die US-Regierung gegen jede Beteiligung
an den Reparationsverhandlungen gesträubt.
12. Dezember
Der Teuerungszuschlag für die Bergarbeiter im
Ruhrgebiet wurde von 25 Prozent auf 10 Prozent
reduziert.
12. Dezember
Kardinal Michael von Faulhaber, der Erzbischof von
München, sah sich einer üblen Hetze der
Rechtsradikalen ausgesetzt. Faulhaber hatte
öffentlich zugunsten der
Juden Stellung bezogen,
weil er im Zusammenhang mit dem Hitler Putsch auf
die Gefahr eines Pogroms aufmerksam gemacht worden
war.
13. Dezember
Gegen die bayerischen Stimmen befürwortete der
Reichsrat den größtmöglichen Beamtenabbau in den
Ländern und Gemeinden, um die öffentlichen Budgets
zu entlasten.
13. Dezember
Ernest Louis Chuard wurde von der schweizerischen
Bundesversammlung zum Bundespräsidenten für das Jahr
1924 gewählt.
13. Dezember
Im Reichsarbeitsministerium fanden Verhandlungen
über die Arbeitszeit in der Schwerindustrie statt.
13. Dezember
Von Rudolf G. Binding lagen neue Gedichte unter dem
Titel „Tage“ vor.
14. Dezember
In Thüringen erzwangen die bürgerlichen Parteien
gemeinsam mit den Kommunisten die Auflösung des
Landtages.
14. Dezember
Nach einer Misstrauenserklärung der DDP trat auch
die sächsische Landesregierung zurück.
14. Dezember
Die Arbeitszeit in der Schwerindustrie und im
Bergbau wurde erheblich verlängert, durchschnittlich
auf 9–10 Stunden, für Hüttenarbeiter zum Teil bis
auf 59 Wochenstunden.
14. Dezember
Das Reichskabinett setzte die Arbeitszeit für Beamte
auf mindestens 54 Wochenstunden fest.
14. Dezember
Von Leo Weismantel erschien die Erzählung „Die
Hexe“.
15. Dezember
Der deutsche Geschäftsträger in Paris, Leopold von
Hoesche machte den Vorschlag, dass die deutsche und
die französische Regierung in direkten
Meinungsaustausch über die Zustände in den besetzen
Gebieten an Rhein und Ruhr treten sollten. Der
französische Ministerpräsident Raymond Poincaré
stimmte dem Vorschlag am nächsten Tag zu.
15. Dezember
Seit ihrer statistischen Erfassung wurde der bisher
höchste Stand der Arbeitslosigkeit erreicht. Fast
3,5 Millionen sind arbeitslos und 2,34 Millionen
Kurzarbeiter.
15. Dezember
Die Rudolf Karstadt AG in Hamburg erhöhte ihr
Aktienkapital auf 750 Millionen Mark.
15. Dezember
Die Operette „Senora“ von Rudolf Presler hatte am
Künstlertheater in Berlin Premiere.
16. Dezember
In Mainz schloss Reichsverkehrsminister Rudolf
Oesner mit den Besatzungsmächten im Ruhr- und
Rheingebiet ein Abkommen zur Normalisierung des
Eisenbahnverkehrs.
16. Dezember
In Berlin wurden 300 Personen, die zu einem
Kommunisten-Kongress aus dem ganzen Deutschen Reich
in die Hauptstadt gekommen waren, von der Polizei
festgenommen. Der Kongress war verboten worden.
17. Dezember
Die deutschen Reichsbeamten und -angestellten
erhielten wegen der finanziellen Notlage nur die
Hälfte ihrer Bezüge für die zweite Monatshälfte
ausgezahlt. Am 21. Dezember sollten sie den Rest
erhalten.
17. Dezember
Der Landtag setzt die Kommunalwahlen in Preußen auf
den 4. Mai des nächsten Jahres fest.
18. Dezember
Reichsernährungsminister Graf Kanitz leitete in
Berlin die Konferenz seiner Ressortkollegen aus den
deutschen Ländern, um Maßnahmen gegen die Notlage zu
treffen.
18. Dezember
Die Verhandlungen über Tanger, die seit dem 27.
Oktober in Paris geführt wurden, wurden mit der
Unterzeichnung eines Abkommens zwischen Frankreich,
Großbritannien und Spanien. Seit 1912 unterstand die
Stadt und ihr Umland der Souveränität der drei
Länder.
19. Dezember
Die KPD Forderte Neuwahlen in Sachsen und lehnte
eine Koalition mit der SPD zurzeit ab.
19. Dezember
Im bayerischen Landtag scheiterte das
Ermächtigungsgesetz der Regierung an der fehlenden
Zweidrittel-Mehrheit. Der Bauernbund schied aus der
Koalition aus.
19. Dezember
Mit der zweiten Steuernotverordnung wurden die
großen Reichs- und Landessteuern wie Einkommens- und
Körperschaftssteuer, Vermögenssteuer,
Erbschaftssteuer, Umsatzsteuer, usw. den veränderten
Währungs- und Wirtschaftsverhältnissen angepasst.
19. Dezember
Die Kohlenpreise wurden in zwei Stufen um
durchschnittlich 10–17 Prozent gesenkt. Die
Acht-Stunden-Schicht wurde wieder aufgehoben. Da die
Verhandlungen über das Kohlensyndikat gescheitert
waren, ordnete der Wirtschaftsminister eine
Zwangsverlängerung an.
19. Dezember
Auf Vorschlag des Reichsrates wurde Dr. Hjalmar
Schacht neuer Reichsbankpräsident. Der Diskont der
Reichsbank wurde auf 90 Prozent, der Lombardzinssatz
auf 10 Prozent festgesetzt.
20. Dezember
Arbeiter, die die zehn-Stunden-Schicht verweigerten
wurden von den Krupp Werken in Rheinhausen
entlassen. Die Betriebe mussten daraufhin schließen.
21. Dezember
Gegen die Stimmen der DNVP und der KPD, deren
Misstrauensanträge abgelehnt wurden, verabschiedete
der Landtag von Württemberg ein Ermächtigungsgesetz.
21. Dezember
Auf Basis des Ermächtigungsgesetzes vom 8. Dezember
erließ der Reichsarbeitsminister eine
Arbeitszeitverordnung, die den Acht-Stunden-Tag als
Norm anerkennt, aber eine Fülle von Ausnahmen
zulässt.
21. Dezember
Das russische Revolutionsschauspiel „Emigranten“ von
Fjodor Karpoff wird mit Rosa Valetti im neuen
Theater Comedia Valetti in Berlin uraufgeführt.
21. Dezember
Der Film „Vineta, die versunkene Stadt“ wurde im
Primus Palast in Berlin uraufgeführt.
22. Dezember
Reichswährungskommissar Dr. Hjalmar Schacht (DDP)
wurde vom Reichspräsidenten zum Präsidenten der
Reichsbank ernannt. Er blieb weiterhin
Währungskommissar.
22. Dezember
Als erstes Stück in Berlin inszenierte
Theaterregisseur Erich Engel, der von München
gekommen war, Dietrich Grabbes „Scherz, Satire,
Ironie und tiefere Bedeutung“.
23. Dezember
Die französische Kammer billigte mit 329 gegen 211
Stimmen eine Teuerungszulage für Beamte.
Ministerpräsident Raymond Poincaré hatte die
Abstimmung mit der Vertrauensfrage verbunden.
23. Dezember
Die Gewerbesteuer wurde durch eine Verordnung
vorläufig geregelt.
24. Dezember
Der deutsche Geschäftsträger in Paris, Leopold von
Hoesch, überreichte dem französischen
Ministerpräsidenten Raymond Poincaré eine Note der
Reichsregierung über Wirtschafts- und
Verwaltungsfragen in dem besetzten Gebiet.
24. Dezember
Das Stück „Utopia“ von Hanna Rademacher wurde im
Neuen Schauspielhaus in Königsberg uraufgeführt.
25. Dezember
Reichskanzler Wilhelm Marx richtet in der
Radiostunde einen Weihnachtsgruß an das deutsche
Volk.
25. Dezember
Der Film „Das Geheimnis von Brinkenhof“ mit Henny
Porten und Paul Henckels in den Hauptrollen wurde in
der Alhambra am Kurfürstendamm in Berlin
uraufgeführt.
26. Dezember
Laut ihres Beschlusses vom 30. November berief die
Reparationskommission zwei internationale
Sachverständigenausschüsse zur Untersuchung der
deutschen Finanzverhältnisse. Vorsitzender des
ersten Komitees war der US-Amerikaner Charles Gates
Dawes. Das zweite Komitee wurde von dem Briten
Reginald McKenna geleitet. In beiden Ausschüssen
saßen US-amerikanische, britische, französische,
italienische und belgische Finanzexperten.
26. Dezember
Der Antisemit und nationalsozialistische
Hauptschriftleiter des „Völkischen Beobachter“
Dietrich Eckart starb in Berchtesgaden im Alter von
55 Jahren. Im Jahr 1925 wurden seine „Zwiegespräche
mit Adolf Hitler“ und 1928 „Ein Vermächtnis“ von
Alfred Rosenberg herausgebracht.
27. Dezember
Regierungspräsident Grützner wurde von einem
französischen Kriegsgericht in Düsseldorf wegen des
Separatisten Putsches vom 30. September zu 20 Jahren
Zuchthaus verurteilt.
27. Dezember
Ein Kommunist verübte auf den japanischen
Prinzregenten Hirohito ein erfolgloses Attentat.
27. Dezember
Ein für den 28. Dezember in Spanien geplanter
kommunistischer Aufstand wurde durch die Verhaftung
der Anführer in Madrid und einigen Provinzen
verhindert.
27. Dezember
Das Internationale Rote Kreuz rief zu Sammlungen für
Deutschland auf.
28. Dezember
Auf Basis des Ermächtigungsgesetzes vom 8. Dezember
erließ die Reichsregierung eine Verordnung über
Goldbilanzen, die den Unternehmen die Aufstellung
von Goldmarkbilanzen ab dem 1. Januar 1924
vorschrieb.
28. Dezember
In Bonn starb der Historiker Moritz Ritter im Alter
von 83 Jahren.
29. Dezember
Die Bayerische Volkspartei beschloss, ein
Volksbegehren zu einer Verfassungsänderung
einzuleiten. Sie wünschte die Einführung eines
Staatspräsidenten in Bayern.
30. Dezember
In Aachen wurden mehrere Deutsche von einem
belgischen Kriegsgericht wegen Sabotage zu
lebenslänglichen Zuchthaus oder hohen
Freiheitsstrafen verurteilt.
31. Dezember
Kanada schloss seine Häfen für Fischerboote aus den
USA, um gegen die hohen US- Einfuhrzölle zu
protestieren.
31. Dezember
Der britische Biologe Sir Julian Sorell Huxley hob
in der Zeitung „The Daily Herald“ die Bedeutung des
neuen mittels gegen die tropische Schlafkrankheit
hervor, das die Firma Bayer entwickelt hatte.
31. Dezember
In einem Jahr verließen den Alten
Bergarbeiterverband 100 000 Mitglieder, also 25
Prozent.
31. Dezember
Das Inflationsjahr brachte 100 neue deutsche
Briefmarken.
31. Dezember
Die Arbeitslosigkeit erreichte mit 1,47 Millionen
Unterstützungsempfängern einen dramatischen
Höhepunkt. Die Gewerkschaften melden 28,2 Prozent
Erwerbslose und 42,2 Prozent Kurzarbeiter. Von 1878
Streiks in 21500 Betrieben waren 1923 1,75 Mill.
Arbeiter betroffen. Bei 168 Aussperrungen in 2700
Betrieben wurden 165 000 Arbeiter erwerbslos.
Dadurch gingen 1,33 Millionen Arbeitstage verloren.
Durch die Streiks verlor die Wirtschaft 11,15
Millionen Arbeitstage.
Wer
hat im Dezember 1923 Geburtstag >>
Dezember 1923 in den Nachrichten
>>>
Werbung
<< Das
geschah 1922
|
Das geschah 1924 >>