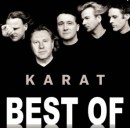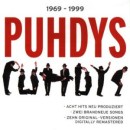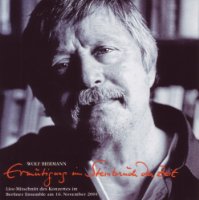Musikgeschichte der DDR
Von der
Gründung der DDR am 7. Oktober 1949 bis zu
ihrem Ende hatte sich in diesem deutschen Staat eine
eigene Musikkultur entwickelt, bei der sich die
Freiheit der Kunst allerdings den Richtlinien der
diktatorischen Partei- und Regierungsführung
weitestgehend unterzuordnen hatte. Dessen ungeachtet
versuchten Musiker in allen Bereichen, auch in der
so genannten E-Musik, die Grenzen des Machbaren
auszuloten, weil sie auch in ihrem musikalischen
Schaffen bestrebt waren, ihre Meinungsfreiheit und
ihre Sicht auf die Situation in der DDR
auszudrücken. Der Schlagerbereich war davon am
wenigsten betroffen.
Rock- und Popmusik in der DDR
Die Rock- und Popmusik, die damals in ganz
Deutschland noch Beatmusik genannt wurde, bekam ihre
eigene Richtung nicht sofort nach der Gründung der
DDR. Zunächst orientierten sich die Menschen im neu
gegründeten Staat noch an der Musik in der BRD und
den Einflüssen aus der amerikanischen Szene. Der
erste Staatsratsvorsitzende der DDR, Walter Ulbricht
(1893-1973), der von 1949 bis 1971 regierte, lehnte
die westliche Musik in jeglicher Form ab, vor allem
die Beatmusik und ordnete an, dass es in der DDR
eine eigene Unterhaltungsmusik zu geben hatte. Die
sollte sich von den „wilden“ Klängen des
Nachbarlandes unterscheiden, die
ohnehin nur Gift
für die werktätige Bevölkerung waren, wie es
öffentlich dazu hieß.
1959 wurde deshalb eigens für die DDR-Bevölkerung
ein Tanz kreiert, der wohl den Nichttänzern im
Politbüro eingefallen sein musste – Lipsi. Er sollte
den Rock'n'roll aus den Köpfen verdrängen. Der neue
Tanz fand kaum Anhänger und verschwand so schnell,
wie er aufgetaucht war. Anders war es mit dem Twist,
der in den frühen 1960er Jahren aufkam. Seine
Ursprünge lagen in der afroamerikanischen Musik. Er
war auch eine Ära in der westlichen Musik, wurde
aber von der DDR als „harmlos“ eingestuft.
Tanzmusik, zu der man tatsächlich tanzen konnte, gab
es in den Anfangsjahren der jungen Republik häufig
als Einspielungen ohne Text zu kaufen. Das Englische
wurde mit der westlichen Musik identifiziert, war
also verpönt. Dann lieber gar kein Text, dachten
sich viele Musiker und schrieben zu ihrer Musik dann
auch keine deutschen Texte.
Rockbands hatten es in der Ulbricht-Ära schwer. Vor
allem Mitte der 1960er Jahre war das Vorgehen gegen
diese Bands noch von harter Gangart.
Als 1965 in der Westberliner „Waldbühne“ ein Konzert
der „
Rolling Stones“ mit Krawallen und Randale
endete, nahm in der DDR die Intoleranz zu, die
Rockmusik, die von Gruppen wie „Sputniks“ oder
„Butlers“ gespielt worden war und auch die Schaffung
des Jugendrundfunksenders „DT 64“, der in seiner
Programmgestaltung versuchte, freizügiger zu sein –
all das wurde nun wieder besonders streng
begutachtet. Die Musik aus dem Westen wurde
größtenteils nach dem Gehör nachgespielt, von den
Tonbändern, die man privat aufgenommen hatte.
Ulbrichts Zensur war dogmatisch. Unvergessen sind
seine Worte zur Beatmusik aus jener Zeit: „Ich
denke, Genossen, mit der Monotonie des Je-Je-Je, und
wie das alles heißt, ja?, sollten man doch Schluss
machen. […] Ist es denn wirklich so, dass wir jeden
Dreck, der vom Westen kommt, kopieren müssen?“
In der DDR kam es zu einer Debatte auf höchster
Regierungsebene, um gegen die Beatmusik
und ihre
Macher vorzugehen. Sogar der Vorschlag, diese
„Gammler“ in Arbeitslager unterzubringen, wurde
erörtert. Als dann in Leipzig fast alle dort
verzeichneten Gruppen verboten wurden, so auch die
„Butlers“ und „Klaus Renft“ und zudem keines der
geplanten Beatkonzerte stattfinden durfte, zeigten
sich die Jugendlichen empört. Sie gingen auf die
Straße, um ihrem Unmut Luft zu machen. Als
„Beatdemo“ ging diese nicht genehmigte Kundgebung in
die Geschichte ein, einmal mehr, da sie von der
Volkspolizei der DDR und den Kräften der
Staatsicherheit mit Gewalt beendet wurde. Fast 300
Personen wurden verhaftet, von denen einige zu einem
Arbeitseinsatz verdonnert wurden, der in
Braunkohletagenbauen absolviert werden musste.
Als 1971
Erich Honecker (1912-1994) als
Ulbricht-Nachfolger sein Amt antrat, wurden junge,
aufstrebende Bands zwar gefördert, aber streng im
Auge behalten.
Erst in der zweiten Hälfte der
1980er Jahre konnten
diese Gruppen ihre Texte freier gestalten und
tatsächlich auch kritische Songs herausbringen, die
nicht goutiert, aber meist geduldet wurden. Das
Publikum in der DDR, vor allem die junge Generation,
die nicht hundertprozentig gewillt war, in einem
unfreien Land zu leben, lechzte förmlich nach
solchen Texten, deren Musik nun wieder Ähnlichkeit
bekam mit dem, was international angesagt war.
Außerdem hatten die Menschen längst gelernt,
zwischen den Zeilen zu lesen und zu hören. So wurde
mancher Titel landesweit schnell populär, der erst
beim zweiten Hinhören seine Polit-Kritik offenbarte
und
deshalb dem Bürokraten-Auge der Zensur verborgen
geblieben war.
Dennoch waren Auftritte von nebenberuflichen
Musikern nur mit einer staatlichen Erlaubnis
möglich, die sie als „künstlerische Volksschaffende“
auswies. Hauptberufliche Künstler, die eine
Ausbildung absolviert hatten, waren durch ihre
Diplome u. ä. berechtigt, aufzutreten. Doch
insgesamt war es für alle Musiker nicht leicht, sich
mit einem guten, technischen Equipment auszustatten,
erst recht nicht für die Amateurtanzkapellen. Die
Bands, die es in kleiner Besetzung zuhauf gab,
wurden im DDR-Jargon staatlicherseits
„Gitarrengruppen“ genannt. Auf Tanzveranstaltungen
spielten sie mitunter mit Instrumenten, an denen sie
selbst herumgebastelt hatten, wie auch an ihren
Verstärkern. Der neue Klang machte es immerhin
möglich, auch Songs von den Beatles, Titel aus der
Country-Musik oder Blues zu spielen.
Bis zum Ende der sechziger Jahre hatte die Zahl der
Combos, Sextetts oder Quintetts enorm zugenommen.
Musikalisch herausragend waren beispielsweise
Gruppen wie das Günther-Fischer-Quintett oder Thomas
Natschinski und seine Musiker. Die Langspielplatten,
die produziert wurden, waren mit deutschsprachigen
Titeln bestückt.
Die DDR-eigene Musikkultur, die sich herausgebildet
hatte, war in den 80er Jahren zu einer
selbstbewussten geworden, wobei sogar der eine oder
andere Titel im Westen Deutschlands Anklang fand wie
z. B. „Über sieben Brücken musst Du gehen“ von der
Gruppe „
Karat“. Auch die „
Puhdys“ gehörten zu den
Bands, die sich abhoben und von der Jugend mit
Begeisterung gehört wurden.
Der Schlager in der DDR
Auch im Schlagerbereich waren in den Anfangsjahren
die Einflüsse der westlichen Schlagermusik noch
deutlich spürbar. Was in der Bundesrepublik angesagt
war, kannte man auch hinter der Grenze und mancher
Ohrwurm gefiel den Menschen in ganz Deutschland,
unabhängig von ihrer Landeszugehörigkeit. Erst nach
und nach griff die Strenge der staatlichen Organe,
die keine „Westschlager“ tolerierten. Westliche
Rundfunksender wurden zwar gehört, aber es war nicht
erwünscht.
Um die Menschen auch musikalisch und kulturell auf
die Seite des sozialistischen Alltags zu
ziehen,
begann man Ende der sechziger Jahre Musikfilme zu
drehen.
Schlagersänger wie
Frank Schöbel und Chris
Doerk fungierten als Protagonisten, spielten und
sangen in den Leinwandstreifen, die man versuchte,
wie ein Musical zu gestalten (z. B. „Heißer Sommer“,
1968). Diese Filme fanden guten Zuspruch und
streiften keine kritischen Themen.
Die Schlagerszene in der DDR hatte seit dem Ende der
fünfziger Jahre einen engagierten Förderer – Heinz
Quermann (1921-2003). Er war seit 1947 als Leiter
der Unterhaltungsabteilung beim Mitteldeutschen
Rundfunk Leipzig tätig, hatte zahlreiche
Sendeformate entwickelte, die er selbst moderierte.
Schlagersendungen wie „Das Schlagermagazin“
(Berliner Rundfunk) und die Fernsehsendung
„Schlagerstudio“ waren jahrelang mit seinem Namen
verbunden. Durch die TV-Sendung „Herzklopfen
kostenlos“ war Quermann auch als Entdecker vieler,
später namhafter Schlagersänger bekannt geworden.
Unter anderem Dagmar Frederic, Frank Schöbel und
auch
Helga Hahnemann wurden dank seiner Förderung zu
beliebten Schlagersängern, teilweise auch über die
Zeit der Wende hinaus.
Das DDR-Plattenlabel „Amiga“ hatte im Schlager-Genre
eine enorme Produktionsquote. Die Komponisten (Arndt
Bause, Ralf Petersen, Gerd Natschinski u. a.) und
Texter (Gisela Steineckert, Fred Gertz, Kurt Demmler
u. a.) dieser Produktionen hatten teilweise einen
ebenso bekannten Ruf wie die Interpreten selbst.
Doch mitunter waren die Grenzen zur Rockmusikszene
fließend und nicht selten schrieben sie auch Texte
und Musiken außerhalb des Schlagerbereiches. Die
Schlagerinterpreten traten meistens allein auf,
wurden von Orchestern begleitet und nur
Ausnahmekünstler wie z. B. u. a. Veronika Fischer
hatten eine eigene Band.
Zur Schlagerszene in der DDR zählten auch die Sänger
aus osteuropäischen, befreundeten Ländern, deren
Texte in deutscher Sprache interpretiert wurden. Zu
den bekannten Schlagerstars des Ostens gehörten u.
a. Václav Neckář (Tschechoslowakei), Zsuzsa Koncz
(Volksrepublik Ungarn), aber auch der gesamtdeutsch
bekannte Karel Gott aus Prag.
Es gab Schlagerfestivals, die als international
bezeichnet wurden, aber meist nur aus den Künstlern
der sozialistischen Bruderländer bestanden, außer
dem „Internationalen Schlagerfestival der
Ostseeländer“. Die Schwedin Nina Lizell hatte
beispielsweise einen großen Plattenabsatz in der
DDR.
Und außerdem... Sonstige Musik der DDR
Da sich viele Lieder nicht eindeutig einer Schublade
zuordnen ließen, damit auch die Interpreten
musikalische Grenzgänger waren, sei hier nur
erwähnt, dass der Schlagergesang auch häufig das
Genre der Stimmungslieder bediente. Das konnte ein
einzelnes Lied sein, das ein bekannter Sänger zu
einem Hit machte, es konnte aber auch eine Rockband
sein. Aber in umgekehrter Weise gelang es einem
Schlagersänger auch Furore mit einem progressiven
Titel zu machen. Hier waren keine genauen
Festlegungen an der Tagesordnung. Je stabiler die
DDR politisch zu sein schien, desto lockerer wurde
die Zensur gehandhabt. Das machte sich besonders in
den achtziger Jahren bemerkbar, obwohl gerade in
jener Zeit die Stabilität merklich nachließ,
scheinbar aber als gefestigt angesehen wurde,
jedenfalls in den Regierungskreisen.
Einen besonderen Platz im Musikleben der DDR hatte
das Chanson. Es war fast immer mit einer mehr oder
weniger politischen Aussage versehen und seine
Interpreten waren meist Schauspieler, die aber auch
zahlreiche Schallplatten mit Lieder aus Stücken von
beispielsweise Bertolt Brecht/Kurt Weill o. ä.
herausbrachten. Allen voran die international
bekannte Schauspielerin Gisela May, die mit ihren
Brecht-Interpretationen durch die Welt tourte und
nicht
nur dem Chanson, sondern auch der sogenannten
ernsten Musik zugeordnet werden konnte.
Aber auch Manfred Krug hatte einen angesehenen
Status als Sänger. Seine Platten, die er vorrangig
mit Günther Fischer erarbeitete und die auch dem
Jazz zugeordnet werden konnten, waren schnell
vergriffen.
Hingegen hatten es Liedermacher der jüngeren
Generation schwer in der DDR, denn einer echten
Kritik verschloss sich das Land zunehmend, wie die
Ausbürgerungsaktion 1978 zeigte, die die Rückreise
Wolf Biermanns von einem Konzert aus Westdeutschland
verhinderte. Die Protestwelle war groß, Biermann
wirkte in der DDR nun auch ohne seine Lieder weiter,
weil ihn nun jeder kannte, der von ihm vordem noch
nichts gehörte hatte.
Die Komponisten der Neuen Musik – Hanns Eisler
(schuf mit Johannes R. Becher die Nationalhymne der
DDR), Paul Dessau, Günter Kochan u. a. – hatten,
obwohl sie aus dem Exil in die aufstrebende DDR
gekommen waren, keine Narrenfreiheit in ihrem
künstlerischen Schaffen. Sie mussten ihre
musikalische Arbeit in den Dienst des
sozialistischen Realismus stellen und bekamen das in
ihren Aufträgen entsprechend angewiesen. Das von
Ernst Hermann Meyer geschaffene „Mansfelder
Oratorium“ ist nur eines dieser Beispiele, wobei
hier keinesfalls an der musikalischen Qualität etwas
ausgesetzt werden soll.
Die Komponisten der ernsten, der Neuen Musik, waren
angehalten, auch Lieder für die Massen zu schaffen.
Bis zum Beginn der 1960er Jahre hatte hier die
„Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten“ (Stakuko)
das Sagen. Doch mit den Jahren fand eine immer
deutlichere Loslösung von den Forderungen des
Staates statt. Keinem Künstler kann man auf Dauer
vorschreiben, was er zu schaffen hat.
Seit 1967 fand regelmäßig das „Internationale
Festival der zeitgenössischen Musik“ einmal im Jahr
in Ost-Berlin statt. In den achtziger Jahren,
konkret seit 1987, gab es dann die „Dresdner Tage
der zeitgenössischen Musik“, die von Udo Zimmermann
initiiert worden waren.
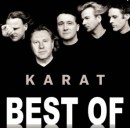
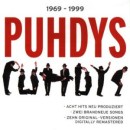
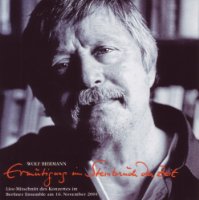
Musik der 60er
Jahre
Schlager & Stars:die 60er Jahre
Die besten Schlager der 60er, 70er und
80er Jahre
Der 60er Jahre Hitmix
Die Charts der 60ziger
Schlagerhits und Schlagercharts der
Sechziger Jahre
Internationale Nr.1 Hits 1960-1969
Country Rock Jazz