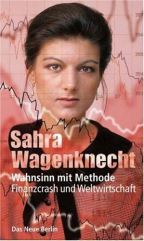Biografie
Sahra Wagenknecht Lebenslauf
Die DDR-Bürgerin Sahra Wagenknecht soll am Tag des
Mauerfalls 1989 zu Hause geblieben sein, um in
Immanuel Kants Klassiker „Kritik der reinen
Vernunft“ zu lesen. Wenige Jahre später war die
häufig mit dem plump-dümmlichen Attribut „Schönstes
Gesicht des Kommunismus“ benannte Thüringerin eine
der bekanntesten deutschen Politikerinnen geworden.
Sahra Wagenknecht wurde am
16. Juli 1969 in der
Universitäts- und Industriestadt Jena als
nichteheliche Tochter einer 21jährigen im
DDR-Kunsthandel arbeitenden Galeristin geboren. Ihr
Vater war ein Iraner, der in West-Berlin studierte
und
1972 nach Ablauf seiner Aufenthaltsgenehmigung
in seine Heimat zurückkehren musste. Der Wunsch der
Mutter ihrer Tochter den in Europa ungewöhnlichen
persischen Namen „Sahra“ zu geben, konnte sich im
Jenaer Standesamtswesen nicht durchsetzen.
Versehentlich oder auch absichtlich wurde
„Sarah“ als Vornamen des Babys eingetragen.
Nichtsdestotrotz hielten Mutter und Tochter im
alltäglichen Verkehr an der Schreibweise „Sahra“
fest.
Die kleine Sahra wuchs in ihren ersten Lebensjahren
vor allem bei ihren Großeltern in dem zu Jena
gehörenden 400-Einwohner-Dorf Göschwitz auf. Die
Mutter studierte in Ost-Berlin und hätte ihr Kind
gerne bei sich gehabt. Sie hätte sich aber nicht
ausreichend um Sahra kümmern können. Das im
Verhältnis zu den anderen Dorfkindern dunkelhäutiger
aussehende Kind wurde nach eigenem Empfinden
ausgegrenzt und entwickelte sich zu einer
Einzelgängerin. Mit sechs Jahren holte sie ihre
Mutter in die Hauptstadt der DDR, wo Sahra
eingeschult wurde. Schon in der Unterstufe der
Polytechnischen Oberschule fiel sie durch ihre
Ernsthaftigkeit, eine gewisse Unnahbarkeit und den
für sie typischen intelligent fragenden Blick auf.
1988 machte Sahra Wagenknecht ihr Abitur an der
Erweiterten Oberschule „Albert Einstein“ im Berliner
Neubauviertel Marzahn. Wegen einiger
Widersetzlichkeiten in der Schulzeit wurde Sahra
Wagenknecht mangelnde Kollektivfähigkeit
vorgeworfen. Deshalb wurde ihr die Aufnahme eines
Studiums verweigert und sie musste als Sekretärin
arbeiten. Im
März 1989 trat die vom Kommunismus
überzeugte und vom DDR-System nicht ganz überzeugte
Sahra Wagenknecht in die SED ein, die sie für
reformfähig hielt.
Nach der Wende studierte sie von 1990 bis 1996 in
Jena (Friedrich-Schiller-Universität), Berlin
(Humboldt-Universität) und Groningen (Rijksuniversiteit)
Philosophie und Literatur. Sie schloss ihr
Magister-Studium mit einer Arbeit über die
Hegelrezeption von Karl Marx ab.
1991 wurde die Studentin in den Parteivorstand der
SED-Nachfolgepartei PDS (ab 2005: Die
Linkspartei.PDS) gewählt. 1995 verlor Sahra
Wagenknecht, die dem extrem linken Flügel der PDS
zugerechnet wurde, ihren Vorstandsposten. Als
Leitungsmitglied der PDS-internen Kommunistischen
Plattform war sie vielen pragmatisch ausgerichteten
Parteitagsdelegierten als zu radikal-orthodox
erschienen. Die vom Verfassungsschutz als
„extremistisch“ eingestufte Kommunistische Plattform
war 1990 als Arbeitsgemeinschaft von PDS-Mitgliedern
gegründet worden, die sich die innerparteiliche
Wahrung und Fortentwicklung marxistischer
Traditionen zur Aufgabe gemacht hatten. Der KPF
wurden 2012 etwa 1200 Partei-Mitglieder zugerechnet.
2005 kehrte Sahra Wagenknecht wieder in den
Parteivorstand zurück und konnte diese Position auch
nach der Fusion der vor allem in Ostdeutschland
präsenten Linkspartei.PDS mit der vorwiegend
westdeutschen linkssozialdemokratischen WASG (Arbeit
& soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative) zur
Die Linke im Juli 2007 behaupten. Im Oktober 2007
wurde sie zudem in die Programmkommission der Partei
gewählt. 2010 gaben ihr 70 % der Delegierten des
Linken-Bundesparteitags das Vertrauen, als
stellvertretende Parteivorsitzende zu fungieren.
2010 erklärte sie ihre KPF-Mitgliedschaft aus
innerparteilichen Gründen für ruhend.
Von 2004 bis 2009 saß Sahra Wagenknecht im
Europaparlament. Im Anschluss gelangte sie bei der
Bundestagswahl 2009 über die NRW-Landesliste, der
Linken-Partei in den Bundestag. 2011 konnte sie sich
gegen ihren Rivalen Gregor Gysi nicht durchsetzen
und musste sich auf dem Parteitag 2011 mit dem
Posten einer dem Fraktionsvorsitzenden Gysi
nachgeordneten 1. stellvertretenden
Fraktionsvorsitzenden begnügen.
Die sich oft zu ökonomischen Themen äußernde
Linken-Politikerin wurde häufig mit dem
überheblichen Totschlag-Argument konfrontiert, als
studierte Philosophin nicht über genügend fundierte
Volkswirtschaftskenntnisse zu verfügen. Diese
angesichts des in Krisensituationen üblichen
politischen Versagens vieler studierter BWL- und
VWL-Entscheider in Wirtschaft und Politik wenig
tragfähige Häme entzog Sahra Wagenknecht im Herbst
2012 die Grundlage. Sie promovierte an der TU
Chemnitz mit einer die Grenzen wirtschaftlichen
Handelns in den Industriestaaten
thematisierenden volkswirtschaftlichen Doktorarbeit.
Damit konnte sie ihrer recht
beeindruckenden Veröffentlichungsliste ein weiteres
Werk hinzufügen. Besonderes Aufsehen haben ihre
programmatischen Analysen „Wahnsinn mit Methode.
Finanzcrash und Weltwirtschaft“ (2008) und „Freiheit
statt Kapitalismus“ (2013) erregt.
Die in Sahra Wagenknechts Veröffentlichungen und
Reden aufgestellten Forderungen und Ansichten haben
regelmäßig zu heftigen Kontroversen innerhalb und
außerhalb ihrer Partei geführt. Insbesondere ihre
Weigerung, die DDR bei aller von ihr geäußerten
Kritik am SED-System als „Unrechtsstaat“ zu
bezeichnen, haben ihr Kritik und teilweise sogar
Feindschaft eingebracht. Andererseits wurden Sahra
Wagenknechts wirtschaftspolitische Ansätze zur
Regulierung des Finanzsystems und insbesondere ihre
Forderung nach stärkerer Inhaftungnahme
spekulierender Banken selbst bei eingefleischten
Anti-Kommunisten wohlwollend aufgenommen. Wenig
wohlwollend wurde Sahra Wagenknecht allerdings im
Januar 2014 vom
Moderator Markus Lanz in einer
ZDF-Talkshow angegangen. Sahra Wagenknechts
höflich-unnahbare Sperrigkeit als Reaktion auf die
Attacken von „Lanz Bulldog“ verhalfen ihr bundesweit
zu Sympathiepunkten.
Anders als manche andere Akteure in der politischen
Arena hat sich Sahra Wagenknecht stets geweigert,
ihr Privatleben instrumentalisieren zu lassen oder
breit zu diskutieren. Zu dieser von ihr als
Privatsache verteidigten Sphäre gehörte auch die
1997 geschlossene und 2013 geschiedene Ehe mit dem
gleichaltrigen Filmproduzenten und
Linken-Abgeordneten Ralph Thomas Niemeyer. Ebenso
die 2011 bestätigte Beziehung zum ehemaligen SPD-
und Linken-Vorsitzenden Oskar Lafontaine (geb.
1943).
Wie das Nachrichtenmagazin Focus mitteilte, war
Sahra Wagenknecht im November 2019 erstmals die
beliebteste Deutsche Politikerin. Laut einer
Umfrage des Instituts Insa, verdrängte sie
Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Platz 2.
Im
November 2019 trat Sahra Wagenknecht
nach vier Jahren als Fraktionsvorsitzende der
Links Partei nicht mehr zur Wahl an. Ihre
Nachfolger wurden
Amira Mohamed Ali und Dietmar
Bartsch. Sahra Wagenknecht wollte sich wegen
Burn-outs aus der ersten Reihe der
Spitzenpolitik zurückziehen. Sie blieb
Abgeordnete im Bundestag und konnte sich
vorstellen, wieder für den Bundestag zu
kandidieren. Wagenknecht wollte die frei
werdende Zeit für Lesen, publizistisch zu
arbeiten und Bücher zu schreiben nutzen. Sie
wollte politisch aktiv bleiben und sich
weiterhin für all die Themen, die ihr am Herzen
liegen, engagieren, wollte aber keine
innerparteilichen Kämpfe mehr austragen.
Sahra Wagenknecht privat
Im
Mai 1997 heiratete Sahra Wagenknecht
Ralph Thomas Niemeyer. Am 12. November 2011
erklärte der ehemalige SPD-Politiker und spätere
Partei- und Fraktionsvorsitzende der Linken
Oskar Lafontaine, dass er und Wagenknecht eng
befreundet seine. Beide lebten von ihren
Ehepartnern getrennt. Seit Juni 2012 wohnen sie
zusammen in Merzig im Saarland. Im Jahr 2014
kurz vor Weihnachten heiratete Sahra Wagenknecht
und Oskar
Lafontaine im saarländischen Merzig in
aller Stille. Ansonsten hält das Ehepaar sein
Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus.
Sahra Wagenknecht Film
Wagenknecht (2020), Regie: Sandra Kaudelka
Der Dokumentarfilm begleitet Wagenknecht und ihr
Team vom Bundestagswahlkampf 2017 bis zu ihrem
Rücktritt aus der Spitzenpolitik 2019.
Sahra Wagenknecht
Seiten
www.sahra-wagenknecht.de - die offizielle
Sahra Wagenknecht Homepage
Sahra Wagenknecht
Bücher
Freiheit statt Kapitalismus: Über vergessene Ideale,
die Eurokrise und unsere Zukunft
Reichtum ohne Gier: Wie wir uns vor dem Kapitalismus retten
Kapitalismus, was tun? Schriften zur Krise