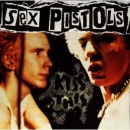Die Ursprünge des Punks
Die eigentliche Geschichte des Punk-Rocks begann
nach Meinung vieler Experten 1975 mit der
Veröffentlichung des „
Ramones“-Albums „Horses“.
Der Musikstil stand in enger Verbindung zu dem
manchmal tatsächlich chaotisch-anarchistisch, oft
aber sich letztlich lediglich
chaotisch-anarchistisch gebenden Lebensstil der
Anhänger, der „Punk“ genannten Jugendkultur, die
ihre Hochzeit als eigenständiger Gegenentwurf zur
Mainstream-Gesellschaft von der Mitte der 1970er bis
Anfang der 1980er hatte. Danach wurde der zunächst
von einer extremen Anti- und
Verweigerungsposition gekennzeichnete Punk als
Musikstil wie auch als Lebensentwurf zunehmend von
der allgemeinen Pop- und Jugendkultur vereinnahmt.
Punk wurde weitgehend zur nahezu rein modischen
Kategorie, die sich zum großen Teil kaum mehr als
durch Äußerlichkeiten, wie den Punk-Versatzstücken
Irokesen-Frisur, Piercings, Sicherheitsnadeln,
Springerstiefel oder bemalten Lederjacken von
anderen Stilrichtungen und Szenen des Kulturbetriebs
absetzte.
Der bis heute lebendige Punk-Rock entwickelte
Ableger und Subgenres, die als „Post Punk“ oder
andere Nachfolgestile zum Teil immer noch von
Bedeutung für die Musikwelt sind. Punk beeinflusste
ferner zahlreiche spätere Musikstile wie Crossover,
Grunge oder Extreme Metal.
Typisch für den üblicherweise von Bands mit einem
E-Bassisten, einem Schlagzeuger, einem Sänger sowie
bis zu zwei Gitarristen gespielten Punk-Rocks ist
sein betont roher und minimalistischer „Drei
Akkorde“- Musikstil mit dem terzlosen Zweiklang des
nicht schwer zu handhabenden „Power
Chord“-Gitarrengriffs. Häufig werden schlichte
Offbeat-Effekte eingebaut, die besonders Tanz
animierend wirken. Ebenso charakteristisch sind
stakkato-schnelle, bis zur Unverständlichkeit ins
Mikrofon mehr gebrüllte als gesungene Textfetzen und
die für gewollte Dissonanzen ursächlichen
Übersteuerungen der Musikverstärker. Die Texte sind
zumeist von aggressiver Grundausrichtung und
transportieren in der Regel Kritik oder Protest im
Zusammenhang mit desolaten persönlichen, sozialen
oder politischen Problemen. Instrumentalstücke sind
ebenso wie lange Intros unüblich. Punk kommt schnell
zur Sache, die einzelne Stücke sind fast immer kurz.
Bei authentischen Punk-Konzerten ist es üblich, dass
die Grenze zwischen Zuschauern und Band fließend
ist. Zuhörer toben sich regelmäßig auf der Bühne aus
und Bandmitglieder springen oft ins Publikum, in der
manchmal trügerischen Hoffnung, dass sie aufgefangen
werden. Dazu passt der Standardtanz der
Punk-Bewegung: der ausgesprochen körperbetonte Pogo.
Beim Pogo springt der Tänzer in kurzen Abständen
kraftvoll auf und ab. Dabei dreht er sich oft in
Hüfte und Oberkörper. Zum Pogo gehört auch das
ständige Anrempeln und Umschubsen der Mittanzenden.
Obwohl ziemlich rüpelhaft, ist die Grundstimmung
beim Pogo doch eher unaggressiv, solange
Punk-Freunde unter sich sind. Angehörige anderer
Jugendszenen fühlen sich dagegen durch
Pogo-Anrempelungen oft provoziert.
Vorläufer und Inspirationsgeber des Punk-Rocks waren
unter anderem der schnörkellose Rock der 1950er
Jahre und der in den 1960ern auf die
naiv-weltverbesserische Einstellung der
Hippie-Bewegung mit düsterem Desillusionismus
reagierende US-Garagenrock. Zu diesen wiederum von
Brit-Gruppen wie „The Who“ oder „Kinks“
beeinflussten
Proto-Punks gehörten „MC5“ , die für Empörung in
Mainstream-Amerika sorgten, weil sie 1969 gewagt
hatten, in ihrem Song „Kick out the Jams“ den
Begriff „Mother****er“ zu verwenden. Ebenfalls zu
den Proto-Punks werden „
The Stooges“, „Television“
und „
Velvet Underground“ gezählt.
Als deutscher
Beitrag zur Vorzeit des Punks wird die
experimentierfreudige Krautrock-Gruppe „Neu!“
(1971-1976) oft zitiert. Der bis dahin vor allem
abwertend als Bezeichnung für „wertlos“ oder für
„asozial“ verwendete Begriff „Punk“ tauchte 1972
erstmals als Benennung für bestimmte Formen des
Garagenrocks auf.
Als erste regelrechte Punk-Gruppe gilt die in New
York gegründete Band „
Ramones“ (1974 -1996), die
neben „The Clash“ und „
Sex Pistols“ zu den
wichtigsten Gruppen dieses Genres gehören. Die einen
relativ poppigen Punk spielenden „
Ramones“ wurden
durch ihre Londoner Auftritte 1976 zum Vorbild für
die englischen „Sex Pistols“ um Johny Rotten und Sid
Vicious, die während ihrer kurzen Band-Historie
(1975-1978) zur Punkband schlechthin geworden waren.
Ihr minimalistischer, häufig mit Reggae-Rhythmen
versetzter Musikstil („Anarchy in the U.K.“, „Never
Mind The Bollocks“) machte die Gruppe ebenso wie der
selbstzerstörerische, von Exzessen, Drogen und
frühen Todesfällen geprägte Lebenstil ihrer
Mitglieder zur Ikone der Punk-Bewegung. Zugleich
stehen die „Sex Pistols“ für die durch die Person
ihres Managers Malcom McLaren symbolisierten Anfänge
der Kommerzialisierung der Bewegung. Dagegen
richtete sich die Haltung der politischsten der
wichtigen Punk-Bands: „
The Clash“ (1976-1985), die
mit ihren Texten („Should I Stay Or Should I Go?“)
Problemfelder wie soziale Diskriminierung und
Polizeiterror thematisierten. In Deutschland
entstanden in dieser Zeit punkähnliche Bands wie
„
Tote Hosen“ (ab 1982) und „Fehlfarben“ (1979-1984).
Ab Ende der 1970er entwickelten sich zahlreiche
Punk-Bands hin zu gefälligeren Musikstilen, die als
„New Wave“ oder „Fun Punk“ rasch
Mainstream-Charakter bekamen. Andere Punks blieben
der raueren Richtung treu und standen Pate für die
vor allem in den USA erfolgreiche „Hardcore“-Bewegung
mit Gruppen wie „
Dead Kennedys“ (1978-1986) sowie
für den britischen anti-kommerzialistischen und
linkspolitischen Oi!-Punk von „Angelic Upstarts“
oder „Cockney Rejects.
Die erfolgreichsten Punk Alben
<
 <
<
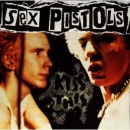


Literatur
Punkrock Bücher
Investment Punk: Warum ihr schuftet und
wir reich werden
Verschwende Deine Jugend: Doku-Roman
über den deutschen Punk und New Wave
Punk Rock: Die Geschichte einer
Revolution
Vegetarische und vegane Rezepte nicht
nur für Punks
The Philosophy of Punk: Die Geschichte
einer Kulturrevolte
Slime: Deutschland muss sterben
Die unzensierte Geschichte des Punk
Erzählt von Lou Reed, John Cale, Patti
Smith, Iggy Pop
Leck mich am Leben: Punk im Osten

 <
<