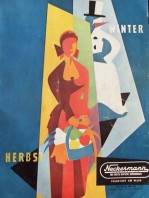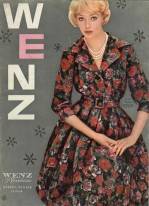DDR-Kleidung -
Eigene und fremde Kreationen
Das selbstbewusste Bild der werktätigen Frau
sollte modisch unterstützt werden. Das betraf
nicht ausschließlich die Arbeitsbekleidung,
sondern vor allem die Freizeit- und Alltagsmode.
So wie sich der Lebensstandard der DDR-Bürger
allmählich zu verbessern begann, wurde auch das
Angebot breiter. Jedenfalls ein wenig. Nicht
zuletzt setzte hier die Regierung auf die
chemische Industrie. Die Produktion von
Kunstfasern wurde voran getrieben. Das wiederum
verhalf der Stoffherstellung zu großem Erfolg.
Auch wenn längst noch nicht alle
Trageeigenschaften zu halten vermochten, was sie
versprachen bzw., was man sich von ihnen
versprach, so war es
doch deutlich zu erkennen,
dass die Arten, die Farben und die Muster
mannigfaltiger wurden. Das hatte positive
Auswirkungen auf die Mode.
Die Damenhose begann sich immer mehr
durchzusetzen. Sie war praktisch und sah gut
aus. Sie wurde mit oder ohne Bügelfalte
angeboten, meist noch mit einem seitlichen
Reisverschluss, durch den sich die Hose von der
Männerhose unterschied. Nach und nach bekam die
Hose einen vorderen Reisverschluss, der
wesentlich bequemer beim Verschließen des
Kleidungsstücks war. So modern die Hose auch
war, für eine Tanzveranstaltung galt sie noch
immer als unangemessen. So war es noch zu Beginn
der
sechziger Jahre. Nicht selten stieß man an
der Eingangstür auf einen entsprechenden
Hinweis, der besagte, dass der Eintritt nur in
tanzgerechter Kleidung gestattet sei. Das
schloss Hosen aus. Heute ist das kaum mehr
vorstellbar.
Auch die Rockmode veränderte sich. Die jungen
Mädchen wagten sich im kurzen Rock auf die
Straße. Anfang der sechziger Jahre hatte Mary
Quant dieses sensationelle Bekleidungsstück
erstmals vorgestellt. In die Haute Couture wurde
er 1964 eingeführt. Das war das Verdienst des
französischen Designers André Courrèges. Bis
Miniröcke und Minikleider in den Alltag
integriert wurden, verging nur wenig Zeit. Und
auch die jungen Mädchen in der DDR nahmen das
freche Röckchen nicht nur wahr, sondern auch
begeistert an. Das löste bei den älteren Frauen
Entsetzen aus, Freude jedoch bei den Männern,
die den Anblick genossen. Außerdem war der
Minirock ein untrügliches Zeichen für die
Jugendlichkeit der Trägerin. Falls im Warenhaus
oder in einem Konfektionsgeschäft kein passendes
Modell zu bekommen war, musste die Mutter sich
schweren Herzen an die Nähmaschine setzen und
ein Röckchen anfertigen, das den Vorstellungen
der Tochter entsprach. Seitens der politischen
Machthaber bestanden keine Einwände gegen den
Mini-Rock. Immerhin.
Feinstrumpfhosen, ein unerlässliches
Kleidungsstück für die Beine, die der Mini-Rock
sichtbar machte, waren sehr begehrt. Die
Chemieproduktion machte diese
Nylon-Beinbekleidung möglich. Doch sie waren
sehr teuer. Wer eine solche in einem Paket der
Westverwandten vorfand, hütete sie sorgsam.
Bekam sie dennoch mit der Zeit eine Laufmasche,
wusste man sich zu helfen und versuchte dieses
Malheur mit Nagellack zu stoppen oder fädelte
sie mit einer winzigen Häkelnadel wieder auf.
Das war mühsam und öffnete einem neuen Gewerbe
die Türen. Es gab bald kleine Geschäfte, in die
man die defekten Beinkleider bringen konnte.
Dort wurden sie für wenig Geld fast unsichtbar
wieder erneuert.
Zu festlichen Anlässen wurden Kleider getragen,
die einen Rock mit einem leichten Ballon-Effekt
hatten. Mit einem breiten Gürtel wurde die
Taille betont und ein kleiner Hut komplettierte
das Aussehen. Auch Kostüme waren unbedingt
gefragt. Der Rock hatte meistens einen geraden,
eleganten Schnitt. Er bedeckte nur knapp das
Knie. Dazu trug Frau eine Jacke deren Silhouette
ebenfalls durch Geradlinigkeit bestach. Die
Ärmel durften mitunter auch dreiviertellang
sein, denn das ließ die Handschuhe dazu besser
zur Geltung kommen. Ein Rundhals-Ausschnitt oder
ein kleiner Kragen variierten das Ensemble. Wenn
der Rock etwas geschwungener war, dann passte
dazu eine längere Jacke, die mit Gürtel getragen
wurde. Sie konnte auch andersfarbig sein.
Ansonsten waren in der Mitte der sechziger Jahre
glatt fallende Kleider modern, die durch auch
schon einmal durch einen Matrosenkragen
auffielen. Ein oder zwei blaue Streifen fanden
sich auch im Saum wieder. Die ärmellosen
Sommerkleider hatten oft übergroße Rocktaschen,
waren schlicht geschnitten und wurden ohne
Kragen gefertigt. Sie waren nicht eng anliegend,
hatten aber auch keine schwingenden Rockteile.
Nicht jedes Kleid bedurfte eines Gürtels. Es gab
auch leicht ausgestellte Modelle, die handbreit
über dem Knie endeten und sehr jugendlich
wirkten. Die Geradlinigkeit, die der äußeren
Form eigen war, fand sich auch in den Mustern
wieder. Hier waren in den 60ern vor allem große,
geometrische Muster angesagt. Sie machten den
Blümchenkleidern und den einfarbigen Modellen
Konkurrenz und wurden gern getragen. Es gehörte
kein besonderer Mut mehr dazu, modisch Farbe zu
bekennen. Im Gegenteil. Farbe war sehr gefragt
und es gab sehr vielseitige Kreationen, die
durch ihre Buntheit auffielen. Auch das war kein
großer Unterschied zum Land nebenan.
Die Ähnlichkeit mit der Mode des westlichen
Nachbarn war unübersehbar. Dennoch waren die
DDR-Modelle keine, die einfach nur abgeschaut
worden waren. Damit täte man den Modemachern
Unrecht. Sie hatten durchaus eigene Ideen und
kreierten ihre eigenen Trends, die dann auf den
Modenschauen im Land gezeigt wurden. Es war
normal, dass sich Mode im internationalen Rahmen
gegenseitig beeinflusste und davon war die DDR
nicht ausgenommen.
Ein Trend, den sie nicht hervorbrachte, der
dennoch das Straßenbild zu beherrschen begann,
war der Nylonmantel, der auch „Nato-Plane“
genannt wurde. Dieses Kleidungsstück war das
Highlight eines jeden Westpaketes. Der
Nylonmantel sah nicht gerade schick aus – weder
in Ost noch in West – doch er war der letzte
Schrei und jede Frau jüngern und auch älteren
Jahrgangs wollte ihn haben. Gegen den
praktischen Effekt als Regenschutzmantel ließ
sich nichts einwenden. Auch nicht gegen die
Leichtigkeit, die es ermöglichte, ihn
zusammengefaltet in der Handtasche bei sich zu
tragen. Doch was vor Regen schützte, schützte
auch vor Frischluft. In diesen Mänteln
schwitzten die Träger sehr leicht. Übrigens
waren diese Nato-Planen Mäntel, die von Frauen
und auch von Männern getragen wurden. Heute
haben sie fast Kultstatus und auch den Status
einer Modesünde.
Konnte sich der Nylonmantel noch in ganz
Deutschland durchsetzen, so hatte
in der DDR der
Parka einen sehr schlechten Ruf an oberster
Stelle. Das machte ihn für junge Leute natürlich
umso attraktiver. Besonders diejenigen, die
nicht mit dem Gesellschaftssystem konform
gingen, glaubten, darin einen leisen Protest
ausdrücken zu können, ohne anfechtbar zu sein.
Der Parka war als Ami-Kutte verpönt. Oder
geliebt. In den einschlägigen Modegeschäften
gehörte er nicht zur angebotenen Konfektion.
Auch hier waren die Träger auf die
Verwandtschaft im anderen Teil Deutschlands
angewiesen.
Zu den in der DDR geächteten Kreationen der
westlichen Welt gehörten auch die Jeans. Was in
der ganzen Welt zunehmend getragen wurde, galt
in der DDR als – vorsichtig ausgedrückt –
untragbar. Seltsam, denn den praktischen Effekt
erfüllte gerade diese Hose unbedingt. Sie hatte
auch Trageeigenschaften, die ihr eine sehr lange
Lebensdauer verschafften. Da sie sich
in der BRD
und auch international immer mehr durchzusetzen
begann, war sie für die jungen Leute in DDR erst
recht interessant. Bekannte und Verwandte im
Westen konnten Abhilfe schaffen. Doch wer sich
in der Schule oder an der Uni damit sehen ließ,
gefährdete seinen
Lebenslauf. In der Freizeit
konnte man den Trägerinnen und Trägern von Jeans
nicht viel anhaben.
Das typische Bild der Frau in der DDR verbindet
sich immer noch mit einem modischen
Dauerbrenner. Es ist die Kittelschürze, die bei
jeder möglichen und unmöglichen Gelegenheit
getragen wurde. Sie gehörte zur Basis-Garderobe
der Frauen. Sie wurde von den Arbeiterinnen in
den volkseigenen Betrieben getragen, sie war für
Garten- und Hausarbeit unerlässlich und Frau
konnte sich in ihr auch sehen lassen, wenn sie
schnell einmal zur HO-Kaufhalle ging. Die
Kittelschürze konnte anstelle eines Kleides
getragen oder darüber angezogen werden, um die
„richtige“ Garderobe vor diversen
Verschmutzungen zu bewahren. Sie war in jeder
Hinsicht praktisch. Nur eines war sie nicht:
eine Erfindung der DDR-Modemacher. Im Gegenteil.
Wenn man die Kittelschürze als eine für die
ostdeutsche Frau charakteristische Bekleidung
hält, darüber womöglich noch die Nase rümpft,
sollte man bedenken, dass ihr Ursprung viel
älter ist als die DDR jemals wurde. Ihren
Ursprung hat die Kittelschürze nämlich in
Amerika, wo sie als „hooverette“ bereits nach
dem
Ersten Weltkrieg auftauchte. Sie war ein
sogenanntes Arbeitskleid, das zwei überlappende
Seitenteile hatte. War eine Seite unansehnlich,
könnte die andere Seite nach vorn sichtbar
getragen werden. Gehalten wurde sie mit einem
Gürtel, der durch die eine oder andere
Stoffseite gezogen werden konnte. Ein gut
durchdachtes Kleidungsstück, das schon damals
Anklang und begeisterte Trägerinnen fand. Nicht
nur in Amerika. Ihren Siegeszug trat die
Kittelschürze sehr schnell an und sie eroberte
die Körper der Frauen modisch gesehen im Sturm.
Sie also als Charakteristikum der DDR-Damen-Mode
zu bezeichnen, entbehrt jeder historischen
Grundlage. In der DDR wurde sie lediglich den
entsprechenden Trage-Bedürfnissen angepasst.
Hierbei war der amerikanische Ursprung
anscheinend unbedenklich. Übrigens trugen auch
die Frauen
in der BRD dieses Schürzenkleid. Was
den alten und neuen, den amerikanischen und
deutschen Modellen zu einem besonderen Vorteil
gereichte, waren ihre klein- und großblumigen
Muster. Die meisten Flecke gingen optisch in
diesem Farb- und Mustergefüge unter.
Die Palette der Kittelschürzen-Modelle war
enorm. Es gab so viele verschiedenen Kreationen,
dass die Auswahl schwer war. Für jeden Geschmack
und für jeden Zweck gab es die richtige. Sie war
unbestritten praktisch, unterstrich zudem eine
zeitgemäße Sparsamkeit im Umgang mit der
restlichen Garderobe und sie war sehr
kostengünstig zu haben. In Geschäften für
Arbeitsbekleidung. Das war gerade so, als ob
sich die Mode selbst von den Kittelschürzen
distanzierte, was deren langer Beliebtheit
allerdings keinen Abbruch tat. Es gab sie in
einer schier unerschöpflichen Farb-, Form- und
Musterauswahl. Entweder hatten sie einen
farblich abgesetzten Kragen oder gar keinen.
Dann bestachen sie mit einem schlichten
Rundhals-Auschnitt. Es gab sie mit oder ohne
Gürtel. Sie hatten meist eine oder zwei
aufgenähte Taschen. Neben der Farbvielfalt gab
es die Kittelschürze auch einfarbig. Es schien,
als ergösse sich die ganze Kreativität der
Gestalter in diese Kittelschürzen. Und sie
hatten eine unschlagbare Eigenschaft –
vielleicht war diese so typisch für das Land im
Osten Deutschlands: das Material. Vorwiegend
wurden sie aus Nylon gefertigt, der Kunstfaser,
die ab 1959 in der DDR offiziell Dederon genannt
wurde und dem Nylon-Pendant aus dem Westen
entsprach. Dederon konnte leicht bedruckt
werden, war reißfest, leicht waschbar, trocknete
schnell und musste nicht gebügelt werden. Abends
konnte man die Schürze waschen, am nächsten
Morgen konnte Frau sie wieder frisch anziehen.
Das Waschen nach kurzer Zeit war allerdings auch
nötig, denn der Stoff ließ kaum Luft durch und
hätte nach längerer Tragezeit einen
körpereigenen, meist unerfreulichen Geruch
angenommen. Da fast jede erwachsene Frau eine
oder mehrere Kittelschürze in ihrem Besitz
hatte, wirkte sie landesweit wie eine
variantenreiche Uniform. In späteren Jahren
wurde die Kittelschürze dann auch aus anderem,
körperfreundlichen Material hergestellt. So
angeblich typisch sie für die DDR-Frauen war, so
typisch waren eben diese Schürzen auch für die
weiblichen Erwachsenen in der BRD. Sie waren
deutschlandweit unverwüstlich und – sie sind es
heute noch. Kaum ein gut sortiertes Versand-
oder Kaufhaus würde auf diese Bekleidung
verzichten, denn sie waren und sind keine
Ladenhüter. Sie haben die Jahrtausendwende
überstanden und werden immer noch gekauft. In
Ost und West.
Junge Mädchen lehnten diese Kreation ab. Sie
wollten noch nicht erwachsen und bieder
aussehen, schon gar nicht in der Unauffälligkeit
einer weit verbreiteten Bekleidung „unsichtbar“
sein. Sie drängten nach Individualität und
Auffälligkeit. Eben diesem Anliegen versuchte
die DDR-Mode gerecht zu werden. So entstand ein
fast eigener Textilbereich mit einem
eigenständigen Namen – die Jugendmode. Dafür
wurden sogar eigene Geschäfte eröffnet. Das
erste zeigte seine JuMo, so die „offizielle“
Abkürzung, in Berlin. Das war 1968.
Kurioserweise gab zu diesem Anlass bereits ein
Jahr zuvor eine Extra-Ausgabe der Zeitschrift
„Saison“, die rund 80 Modelle ausschließlich für
junge Leute vorstellte. Da war die Gazette der
Eröffnung allerdings zuvorgekommen und wurde
erst einmal zurück gerufen. Über die
Hintergründe kann man mutmaßen, muss man aber
nicht. Nach der Eröffnung des
Jugendmode-Zentrums in Berlin zogen andere
Städte nach. Kaufhäuser hatten auf einmal eine
gesonderte Jugendmode-Abteilung, deren Angebot
mit dem der speziellen Geschäfte identisch war.
In den meisten Fällen war es aber so: Kannte man
ein Geschäft, dann kannte man alle, denn durch
einen individuellen Boutique-Charakter hatten
diese Läden nicht. Höchstens die Berliner
Geschäfte zeichneten sich durch ein etwas
größeres Warenangebot aus.
Wie sah sie nun aus, die JuMo der DDR in den
sechziger Jahren? Vor allem sollte sie mit
frischen Farben verführen. Sie sollte sportlich
und ein bisschen keck sein – jugendlich eben.
Das erfüllten die Modelle auch. Man konnte sich
vorab in den einschlägigen Zeitschriften über
das vermeintliche Angebot informieren, um dann
im Laden festzustellen, dass es das Gewünschte
nicht oder nicht mehr gab, vielleicht auch nie
gegeben hatte. Der Andrang war dessen ungeachtet
groß, zumal auch junge Schlagersänger in dieser
jungen Garderobe abgebildet waren. Denen hätte
man zu gern nachgeeifert. Kurze Röcke mit
Trägern war en vogue. Kurzhosen-Overalls waren
auf den Fotos zu sehen. Jeansblaue Kostüme, die
allerdings nicht aus Jeans-Stoff gearbeitet
waren, ebenso. Und obwohl die Hot Pants
international erst zu Beginn der siebziger Jahre
aufkamen, wurden kurze Höschen gezeigt, die
optisch in den Sportbereich fielen. Da war die
DDR der internationalen Mode-Zeit sichtlich
voraus. Der Mode für junge Leute standen die
neuen Bekleidungsvorschläge gut. Noch in der
ersten Hälfte des 60er-Jahrzehntes waren sie
fast durchweg bieder daher gekommen. Selbst für
die Jugendweihe, dem feierlichen Schritt in die
Welt der Erwachsenen, den die Jugendlichen mit
vierzehn Jahren machten, mussten entweder die
mütterlichen Schneiderkünste oder die
Verwandtschaft im Nachbarland herhalten. Es gab
natürlich besondere Jugendweihe-Garderobe zu
kaufen, aber das Angebot deckte die Nachfrage
nicht, schon gar nicht den anspruchsvoller
werden Geschmack der Vierzehnjährigen. So
gesehen war die Fokussierung auf die Mode für
Teenager zu einem dringlichen Anliegen geworden.
Und die Veränderungen wurden gern angenommen.
Man musste nur genüg Geduld mitbringen, denn in
den Jugendmodezentren war langes Anstehen
angesagt, um endlich in den Laden zu gelangen.
Daran hatten sich die Menschen gewöhnt, so
schien es jedenfalls.
Obwohl die staatlichen Stellen die Bedürfnisse
der Jungend kannten und ihnen ja angeblich
gerecht werden wollten, schienen sie den Wunsch
nach einer guten Jeans dennoch zu überhören.
Cord-Hosen waren angesagt. Ihr Besitz lenkte
aber nicht von den Jeans ab. In der Vielfalt der
Jungmänner-Mode sah es noch düster aus. Wer eine
Jeans hatte, trug sie, ohne sich um die
Einschränkungen zu kümmern. Es war schließlich
ein tolles Gefühl, so eine international
gefragte Hose zu tragen. In den Genuss kamen
allerdings nicht allzu viele Teenies. Ansonsten
kursierten in der Modewelt der Männer und Söhne
Rollkragenpullover neben den Hemden und Pullis,
die höchstens einmal durch eine kräftige Farbe
auffielen, nicht durch einen pfiffigen Schnitt.
Hier konnten und mussten die Mütter und
Großmütter wieder mit ihren Aktivitäten
aushelfen.
Vielleicht waren es die rebellischen
Aktivitäten, die
in der BRD aufkamen und von
denen man in der DDR einiges hörte und im
verbotenen Fernsehen sah, die die
DDR-Mode-Verantwortlichen auf oberster Ebene
veranlassten, die Reglementierungen ein wenig zu
lockern. Man gewann zunehmend den Eindruck, dass
getragen wurde, was gefiel, unabhängig von der
Herkunft eines Kleidungsstückes. Nur eines
zählte für die Jugendlichen: dem braven Look zu
entkommen. Es wurde auch deutlich, dass sich die
internationalen Trends nicht vom Vorhandensein
einer Mauer abschrecken ließen, die DDR dennoch
infiltrierten und schließlich im Straßenbild zu
sehen waren, wenn auch nicht immer zeitgleich
mit dem Modegeschehen
in der BRD oder in Europa.
Doch aufzuhalten waren die Trends nicht.
Auch die Kinder bekamen mehr Farbe in ihre
Garderobe. Der letzte Schrei waren die
entzückenden Dederon-Kleidchen, die es mit oder
ohne Rüschen gab. Kleine Schleifen waren fast
immer an so einem Kleid. Die kleinen Mädchen
liebten den bunt bedruckten Stoff und die Mütter
freuten sich über die Pflegeleichtigkeit der
Kleidchen. Die Kinder gerieten zwar nicht so
schnell ins Schwitzen, aber sie beschmutzten
ihre Kleidung schnell. Da waren die
Dederon-Kleider einfach ideal. Es gab sie im
Handel, als Schnittmuster in den Zeitschriften
oder im Paket der Westverwandtschaft. Sie waren
ein echter Renner. Auch sie waren keine
spezifische DDR-Kinderkleidung, denn es gab sie
in Ost und West gleichermaßen. Sie unterschieden
sich nur im Namen. Das Dederon-Kleid war in der
BRD ein Perlon-Kleid.
Die Garderobe für die Jüngsten wurde stets eine
oder zwei Konfektionsgrößen größer gekauft. Die
Kleinen sollten in die Kleidung „hineinwachsen“.
Das war keine Bosheit den Sprösslingen
gegenüber, es war lediglich ganz praktisch
gedacht.
Die Mode für Männer, egal welcher Altersgruppe
sie angehörten, sah recht brav aus. Hüftlange
Blousons lagen im Trend, die zwei praktische
Brusttaschen aufwiesen. Aber auch Jacken in
schmaler Linienführung mit einem kleinen
Stehbundkragen wurden getragen. Auch hier waren
aufgesetzte Taschen der dekorative Aufputz. Es
gab diese Jacken einfarbig oder mit kleinem
Karomuster. Auch Sakkos in Nadelstreifen-Karo
fanden Anklang, wobei die weißen Trennlinien auf
dunklem Grund dem Muster eine gewisse Feinheit
gaben. Viel Neues hatte die Mode den Männern
jedoch nicht zu bieten. Auch darin unterschied
sich die DDR nicht von der BRD.
Was wäre Mode ohne ihre Accessoires? Sie wäre
unvollkommen. Die Damen und Mädchen in der DDR
machten aus der Not eine Tugend und stellten
auch die meisten ihrer schmückenden
Aufputz-Teile selbst her. Kreativität und
Eigeninitiative waren sie gewöhnt. Die
Schmuckherstellung uferte ein wenig seltsam aus.
Muschel-Ketten lösen in der Rückschau noch keine
besonderen Emotionen aus. Anders der Schmuck aus
kleingeschnittenen Plastik-Trinkröhrchen oder
über einen Bleistift gedrehte Kupferdrähte, die
dann zu einer Rosette geformt wurden. Diese
modischen Zubehörteile waren weit verbreitet. Um
sie zu fertigen, konnte sich, wer nicht genügend
Fantasie hatte, in den einschlägigen
Zeitschriften über die Arbeitsschritte
informieren. Diese Trinkhalm- und Kupferketten
sahen scheußlich aus.
Die Frisuren ähnelten denen im Westen
Deutschlands. Charakteristisch waren halblange
Haarschnitte mit einer Außenrolle. Um dem Ganzen
noch eine besondere Note zu verleihen, wurden
die offenen Haare dabei meist mit einem Band vom
„Ins-Gesicht-Fallen“ bewahrt. Anfangs wurden die
Bänder im Nacken geknotet. Sie konnten auch mit
einem Karabinerverschluss erworben werden. Das
Material war elastisch. Dieses sogenannte
„Klapsband“ war ein echter Klassiker der 60er
Jahre. Ebenso die Aufwertung einer Frisur durch
Haarteile. Doch für so aufwändige Techniken
begeisterten sich eher die erwachsenen Frauen.
Die Jugend war bereits dabei, einen ganz eigenen
Stil zu finden. Daran unterschied sich nicht von
den Teenies der Welt.
Moder aus den 50er Jahren 1950-1959




Empfehlungen 50er Jahre Kleidung
Cocktailkleid 50er Jahre
aktuelle Mode, Damenmode, Herrenmode und Kindermode
Kataloge 50er Jahre Modekataloge

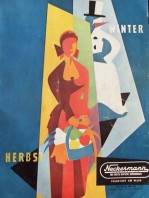

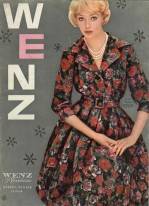
<<
50er DDR Mode
|
60er Mode >>