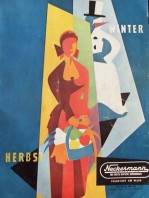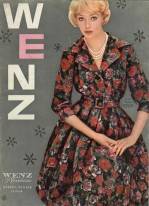Die DDR-Damenmode der 80er Jahre
Zu Beginn des 80er Jahrzehnts hatten sich die
weit geschnittenen Folklorekleider in großer
Vielfalt im ganzen Land etabliert. Sie waren
farbenfroh, wurden mit oder ohne Stickereien
getragen und entsprachen dem Trend. Der hatte
sich sogar bis in die ländlichen Gegenden
verbreitet, denn eine sogenannte Provinz – ein
Begriff, der immer auch eine gewisse
Abfälligkeit beinhaltete – gab es in diesem
Sinne nicht mehr.
Die jungen Frauen wollten in ihrer Freizeit gut
angezogen sein. Für viele war das Selbstnähen
immer noch die beste Möglichkeit, an modische
Kleidung heranzukommen. Doch dieser
Notwendigkeit waren durchaus nicht mehr alle
Frauen bereit zu folgen. Die volkseigenen
Betriebe der Textilindustrie hatten es sich auf
ihre Fahnen geschrieben, den gestiegenen
Bedürfnissen der modernen Frauen Rechnung zu
tragen. Die Bemühungen, auch in den
Konfektionsgeschäften zeitgemäße Kleidung zu
präsentieren, waren groß. Aber Mühe allein
genügte nicht. Planziele mussten erreicht
werden, ohne dabei die Kosten zu erhöhen. Es
gelang nicht.
Doch in den größeren Städten gab es ja seit
etlichen Jahren die Bekleidungsfachgeschäfte der
Exquisit-Handelskette. Und hier wurde fast alles
angeboten, was Frau sich wünschte – zu sehr
hohen Preisen. Besonders reizvoll waren die
Exquisitgeschäfte, weil es dort Import-Mode aus
dem westlichen Ausland zu kaufen gab. Doch Frau
irrte, wenn sie davon ausging, dass ihr
ausschließlich Mode aus dem Westen präsentiert
wurde. Auch wenn es die meisten nicht wahrhaben
wollten – diese Importe machten höchsten 20
Prozent des Textil-Angebotes aus. Der größte
Teil der Bekleidung wurde in der DDR gefertigt
und zwar von den eigens dafür angestellten
Mode-Experten, deren Entwürfe allerdings aus
besten Import-Materialien umgesetzt wurden.
In jeder Saison konnte auf der Leipziger Messe,
die im Frühjahr und im Herbst eines jeden Jahres
stattfand, eine exquisite Kollektion vorgestellt
werden. Diese Kollektionen wurden genau geprüft.
Größere Stückzahlen, die dann in die
Exquisitgeschäfte kamen, wurden erst dann für
die Produktion zugelassen, wenn die
Verkäuflichkeit, die Passform und die
Trageeigenschaften zur Zufriedenheit der
Gutachter ausfielen. War das der Fall, überstieg
die anlaufende Produktion dennoch sehr selten
das Eintausend-Stück-Limit.
Es gab beispielsweise lässige Blazer, deren
Gesamtlänge, die Oberschenkel erreichte und
deren Ärmel vorzugsweise hochgekrempelt wurden.
Sie hatten – das war das Wichtigste – breite
Schulterpartien und waren zudem mit Brusttaschen
zusätzlich zu den aufgesetzten Taschen versehen.
Es fand sich auch die eine oder andere Tasche am
Oberarm. Es gab Hosen, die mit einem Umschlag
versehen waren, der wie „selbstgekrempelt“
aussah und der der Lässigkeit zusätzlich einen
Hauch von Eleganz gab. Saloppe Kleidung war
angesagt, die der Safari-Kleidung ähnelte. Zu
den Blazern konnte Frau auch Röcke tragen. Ob
kurz oder lang hing von dem eigenen Modegefühl
ab. Sogar kurze Hosen, die etwa in Kniehöhe mit
einem gekrempelten Umschlag endeten, waren
modern. Die Exquisitgeschäfte machten es
möglich.
Lange, weit fallende Strickjacken zu Maxiröcken
und Pullover aus dazu passendem Gestrick
gehörten ebenfalls zur begehrten und modisch
aktuellen Bekleidung. Auch die Strickwaren
hatten natürlich gepolsterte Schulternpartien.
Bevor Frau so ein Ensemble aber selbst Masche
für Masche fertigte, wäre die Mode wohl schon
wieder einen Trend weiter gewesen. Also war auch
hier wieder das Exquisitgeschäft zuständig.
Die sogenannten Messemodelle, die hier angeboten
wurden, hatten zweifellos internationalen
Schick. Nicht nur, weil der Glaube an die
Westkleidung überstark war, sondern auch, weil
die Kreationen tatsächlich mit viel Sachverstand
und Gespür entworfen worden waren. Das wurde
möglich, weil es für die Herstellung keine so
gravierenden Kostenbeschränkungen gab wie für
die Massenkonfektion, die den strengen Kriterien
der Planwirtschaft unterworfen war. Im
sogenannten EVP, dem Endverbrauchspreis, drückte
sich das letztendlich mehr als deutlich aus.
Nicht jedem Kleidungsstück sah man seine
exquisite Herkunft an. Es war eine große
Vielfalt auf den Straßen zu sehen. Die Damen
trugen Röcke in verschiedenen Längen. Maxi, Midi
oder Mini – alles hatte zur gleichen Zeit
Bestand. Den Unterschied machten das Alter und
die Figur. Mini hatte sich hartnäckig
eingenistet und war zu einem Charakteristikum
der Teenager geworden. Midi und Maxi wurden von
allen anderen Altersgruppen getragen. Hier
entschied der Anlass über die Länge des Rockes
oder des Kleides. Röcke und Kleider konnten eine
enge Silhouette haben. Sie konnten aber auch
eine lockere Weite aufweisen. Nichts war mehr
streng vorgeschrieben.
Längst war auch die Damenhose zu einer
Selbstverständlichkeit geworden. Mit großer
Weite in den 70ern und mit fast geradem Schnitt
in den 80ern. Manche Hose war knöchellang und
damit nicht länger als die Pantalons, die später
unter dem Namen Leggins noch einmal modern
wurden. Andere Hosen wiederum wurden mit etwas
längerer Saumlänge bevorzugt und waren mit
Bundfalten versehen. Die Bundfaltenhosen hatten
meistens auch eine vordere, durchgehende
Bügelfalte. Diese Hose war zudem mitunter mit
Taschen versehen, in die Frau gern einmal eine
Hand steckte, um lässiger zu wirken als sie
tatsächlich war. Modische Hilfe fürs
Selbstbewusstsein. Das hatten sich die Damen in
den Modezeitungen abgeschaut.
Auch die Baumwollkleider aus Leinen-Windelstoff
oder aus Malimo waren in der Mitte der 80er
Jahre angesagt. Malimo, der Stoff, der seinen
Namen dem Verfahren verdankte, das der Ingenieur
Heinrich Mauersberger in der Nähe von Chemnitz
bereits 1948 entwickelt hatte, war stets eine
gute Alternative für andere, fehlende Stoffe
geworden. Frauen, die selbst nähten, wussten ihn
zu schätzen. In den Anfangsjahren der DDR waren
die Trageeigenschaften von Malimo noch nicht
ausgereift, aber im Laufe der Jahrzehnte hatte
die Weiterentwicklung des Verfahrens für den
gleichnamigen Stoff viel Positives bewirkt. Zwar
galt er nicht als Edel-Stoff, aber er war
solide, preiswert und fand deshalb längst nicht
nur im Bereich der Heimtextilien Verwendung.
In den 80er Jahren gab es bei den Messemodellen,
die man in den Modeheften sah, besonders
entzückende Rock-Modelle. Verschiedene Farb- und
Mustermixe, ungleiche Längen innerhalb eines
Modells und dazu Söckchen und flache Schuhe. Mit
oder ohne Seitentaschen wurden die Kreationen
angeboten. Dazu trug Frau kurze Oberteile,
beispielsweise Blusen, deren Stil sich an die
Safari-Mode anlehnte. Wichtig waren Lässigkeit
und Selbstbewusstsein. Beides sollte in der Mode
seinen Ausdruck finden. Doch ob es sich um
Konfektions- oder Exquisitmodelle handelte;
eines fand während der 80er Jahre auf jeden Fall
Beachtung – die textile Verbreiterung der
Schultern. Hatte ein Kleidungsstück „von der
Stange“ keine Schulterpolster, vollendete Frau
es selbst mit den entsprechenden Achselstücken.
Die waren inzwischen schwer zu bekommen.
Schließlich wurde auch jeder selbstgestrickte
Pullover damit ausgestattet und jede Bluse, die
auf diese Art eine modische Aufwertung erfuhr,
damit ihr die 70er nicht mehr ansehen konnte.
Ohne ausgepolsterte Schulterpartien war Frau zu
jener Zeit nicht vollständig angezogen.
Zum Ende der 80er Jahre rückte die Betonung der
Figur wieder mehr in den Vordergrund. Eng
anliegende, schulterfreie Kleider für den
Sommer, die in verschiedenen Längen an den
Körper kamen, wurden gern getragen. Sie waren
ärmellos oder mit einem kurzen Ärmel versehen,
der einen gewissen Kick durch den Raglanschnitt
bekam. Auch einseitig schulterfrei oder mit
einem langen Rockschlitz versehen, waren sie
nicht nur eine Freude für die Trägerin, sondern
auch ein Hingucker für die Männer.
Besonderen Anklang fanden die Jeans-Modelle, die
immer mehr in den exquisiten Handel kamen. Röcke
und Blazer, Westen und Hosen, alles versuchte
man, um die Damen der jungen und jüngeren
Generation zufrieden zu stellen. Das gelang
allerdings nur selten, denn den DDR-Jeans sah
man ihre Herkunft deutlich an. Die Farbgebung
der Nähte und die Nieten konnten nicht darüber
hinwegtäuschen, auch wenn der im eigenen Land
produzierte Ersatz-Jeansstoff ausgezeichnet
verarbeitet war.
Was immer Frau auch trug, sie wurde modisch sehr
ernst genommen. Die Einkäufe in einem der
Exquisitgeschäfte waren dennoch keine
Selbstverständlichkeit und das Selbstnähen blieb
eine berechtigte, parallele Notwendigkeit. Doch
die Möglichkeiten waren vielfältiger geworden
und die Westverwandtschaft erfüllte ja auch noch
so manchen Wunsch.
aktuelle Mode, Damenmode, Herrenmode und Kindermode
Kataloge 80er Jahre Modekataloge

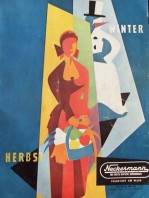

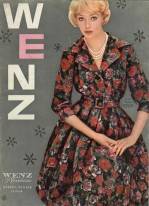 <<
70er DDR Mode
<<
70er DDR Mode
|
90er Mode >>