Geschichte des Sozialversicherungssystems
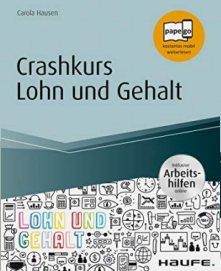
Im deutschen Sozialversicherungssystem
gelten das Solidaritäts
und
das
Subsidiaritätsprinzip.
Jeden Monat, wenn der Arbeitgeber
den wohlverdienten Lohn ausbezahlt, ärgern sich die
Arbeitnehmer über die vielen Abzüge. Doch woher stammen
diese Abzüge? Woher stammt das
Sozialversicherungssystem? Welche Vorteile bringt das
Sozialversicherungssystem?
In Deutschland gibt es ein
gesetzliches Versicherungssystem,
das deutsche Sozialversicherungssystem – mehr
dazu bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Es
ist eine Solidargemeinschaft, die einen wirksamen
finanziellen Schutz gegenüber den großen Lebensrisiken
und deren Folgen bietet. Diese Lebensrisiken sind:
Krankheit, Alter, Betriebsunfälle, Arbeitslosigkeit
sowie Pflegebedürftigkeit. Das deutsche
Sozialversicherungssystem soll einen stabilen
Lebensstandard für jeden Einzelnen garantieren. Dabei
hat sich das System im Lauf der Zeit auch im Hinblick
auf die Europäische Union gewandelt und den aktuellen
Bedingungen der Zeit erfolgreich angepasst.
Sozialversicherungssystem immer ein Thema
In den Unternehmen ist das
Sozialversicherungssystem jeden Monat ein Thema, und
zwar dann, wenn die Lohn- und Gehaltsabrechnungen zu
erstellen sind. Vom Grundprinzip her ist alles ganz
einfach. Aber die Aufgabe ist komplex, es ist an vieles
zu denken. Zu den Sozialversicherungsabgaben muss auch
die Lohnsteuer berechnet werden. Größere Unternehmen,
die es sich leisten können, haben hier eine eigene
Abteilung oder zumindest einen Mitarbeiter, der sich mit
dem Thema auskennt und die Abrechnungen erstellt. Häufig
erfolgt dies mit Softwareunterstützung. Aber auch
kleinere Unternehmen können mit der richtigen Software
ihre Abrechnungen selbst erstellen und somit jeden Monat
Geld sparen. Mit dem
Ratgeber Lohnabrechnung ist es ganz einfach,
die passende Software zu finden.
Subsidiarität und Solidarität im deutschen
Sozialsystem
 Jeder leistet einen kleinen Beitrag, um die
Jeder leistet einen kleinen Beitrag, um die
Risiken
für alle
tragen zu können.
Im
Kern basiert das deutsche Sozialsystem auf zwei
Prinzipien, die die Rahmenbedingungen darstellen. Damit
soll das allgemeine Bedürfnis nach sozialer Sicherheit
befriedigt werden. Das wichtigste Prinzip ist dabei das
Solidaritätsprinzip. Das bedeutet, die
Versichertengemeinschaft trägt gemeinsam die zu
versichernden Risiken. Dies funktioniert gemäß dem
Grundsatz der drei Musketiere: „Einer für alle, alle für
einen.“ Wer in diesem System in eine Notlage gerät und
diese aus eigener Kraft nicht beenden kann, darf damit
rechnen, dass die Gemeinschaft ihn unterstützt und ihm
aus dieser Notlage heraushilft. Das zweite wichtige
Prinzip ist das Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, dass
jedes Individuum zunächst einmal selbstständig versuchen
muss, seine Notlage zu beenden. Erst wenn dies nicht
gelingt, greift das Solidaritätsprinzip.
Das Prinzip „Selbsthilfe“
Diese
Prinzipien lagen schon den „Selbsthilfeeinrichtungen“ im
14. Jahrhundert zugrunde, die es damals im Bergbau und
im Handwerk bereits gab. Erkrankte oder verunglückte
Kollegen und deren Familien fanden bei Bedarf in diesen
Einrichtungen Unterstützung durch die Arbeitskollegen.
In der Wissenschaft gelten diese ersten
Selbsthilfeeinrichtungen als Vorläufer des heutigen
Sozialversicherungssystems.
Durch die Industrialisierung und
die Erfindung der Dampfmaschine im 19. Jahrhundert
veränderte sich alles. Da, wo Rohstoffe vorhanden waren,
entstanden große Fabriken. Günstige Betriebsstandorte
wurden geschaffen. Der dadurch ausgelöste
Wirtschaftsboom lockte die Menschen aus allen
Landesteilen zu den Fabriken. Sie versprachen sich, dort
Arbeit sowie ein besseres Leben zu finden. Gleichzeitig
gaben sie ihr soziales Sicherungsnetz auf, das zum einen
durch die Arbeitskollegen und zum anderen durch die
damals vorherrschende Großfamilie gewährleistet war. Die
fortschreitende gesellschaftliche Entwurzelung führte
dazu, dass die Armut in der Bevölkerung immer mehr
zunahm. Das erkannte der preußische Staat und führte
zunächst die staatliche Armenpflege ein. Im nächsten
Schritt entstand eine der ersten Sozialversicherungen.
So begann die gesetzliche Sozialversicherung
Am 17. November 1881 leitete
Kaiser Wilhelm I. mit seiner Kaiserlichen
Botschaft den Aufbau einer Arbeitnehmerversicherung ein.
Treibende Kraft dabei war der Reichskanzler Otto von
Bismarck.
Mehr über Otto von Bismarck ist bei
planet-wissen.de zu erfahren. Der Staat sollte von nun
an für die Existenzsicherung der Bürger verantwortlich
sein. Folgende Grundsätze waren dabei relevant:
-
Die
Versicherten zahlen Beiträge in ein
Rentenversicherungssystem, aus dem die Rente
finanziert wird.
-
Der Staat beteiligt sich an der
Sozialversicherung und hat die Aufsicht darüber.
-
Es gilt das Selbstverwaltungsprinzip.
Dabei haben Arbeitgeber und die Versicherten volles
Mitspracherecht. Eine gewählte Vertreterversammlung
vertritt die Interessen.
-
Der Arbeitgeber beteiligt sich an den Beiträgen für
die Sozialversicherungen.
Im Jahr 1883 kam zu dieser
Rentenversicherung die Krankenversicherung hinzu und
1884 die Unfallversicherung. Im Jahr 1889 war es
erstmals möglich, dass sich Arbeitnehmer gesetzlich
gegen die Folgen von Invalidität und Alter absichern
konnten. Die Regierung baute das Sozialsystem in
Deutschland in den folgenden Jahren immer weiter aus.
Im Jahr 1912 entstand die
Sozialversicherung für Angestellte.
Seit
dem Jahr 1927
existiert die Arbeitslosenversicherung. Der jüngste
Zweig im deutschen Sozialversicherungssystem ist die
Pflegeversicherung, die
seit 1994 in mehreren Stufen
eingeführt wurde.
Weiterer Ausbau nach dem Krieg
Nach dem
Zweiten Weltkrieg wurde
das System der sozialen Sicherung in Deutschland bis
Mitte der 1970er-Jahre weiter ausgebaut. Nach dem Krieg
war die deutsche Wirtschaftskraft zerstört, die
Beitragszahlungen gingen aufgrund der hohen
Arbeitslosenzahlen stark zurück, sodass insbesondere die
Rentner in beiden Teilen des damals geteilten
Deutschlands die Leidtragenden waren. Die
Rentenversicherer gerieten in finanzielle Probleme,
Altersarmut breitete sich aus. Auch der wirtschaftliche
Aufschwung in den Wirtschaftswunderjahren der 1950er-
und 1960er-Jahre verbesserte die Situation nicht
wesentlich. Den Unternehmen ging es gut, sie konnten
ihren Kunden
Rechnungen schreiben und verdienten
entsprechend Geld. Doch die gesetzliche Rente war nicht
an die Wirtschaftsentwicklung gekoppelt und blieb
dadurch auf dem niedrigen Niveau. Erst die Rentenreform
1957 verbesserte die Situation. Ziel war es, den
Lebensstandard der Beitragszahle für die Zeit des
Ruhestandes zu sichern.
Krankenversicherung – Reform in den 1970er-ahren
1974 wurden das Leistungsverbesserungsgesetz
und das Rehabilitationsgesetz eingeführt. Darüber hinaus
kam es zu einer Erweiterung des Kreises der
Versicherten. Dadurch stiegen natürlich die Ausgaben.
Dem sollte ein Gesetz, das von 1977
bis 1983 galt,
entgegenwirken: das sogenannte Kostendämpfungsgesetz.
Diese Maßnahme war allerdings lediglich kurzfristig
wirksam. Die Kostenentwicklung machte das
Gesundheits-Reformgesetz notwendig, das 1989 schließlich
verabschiedet wurde. Das war die letzte große Reform vor
der Wiedervereinigung der Bundesrepublik Deutschland.
Der Mauerfall 1991 stellte für die Krankenversicherungen
eine große Herausforderung dar. Der
Einigungsvertrag vom 31. August 1990 hatte
zur Folge, dass das bundesdeutsche
Krankenversicherungsrecht auch im Osten der Republik
galt.
Mehr zum Thema
Entwicklung der Versicherer

